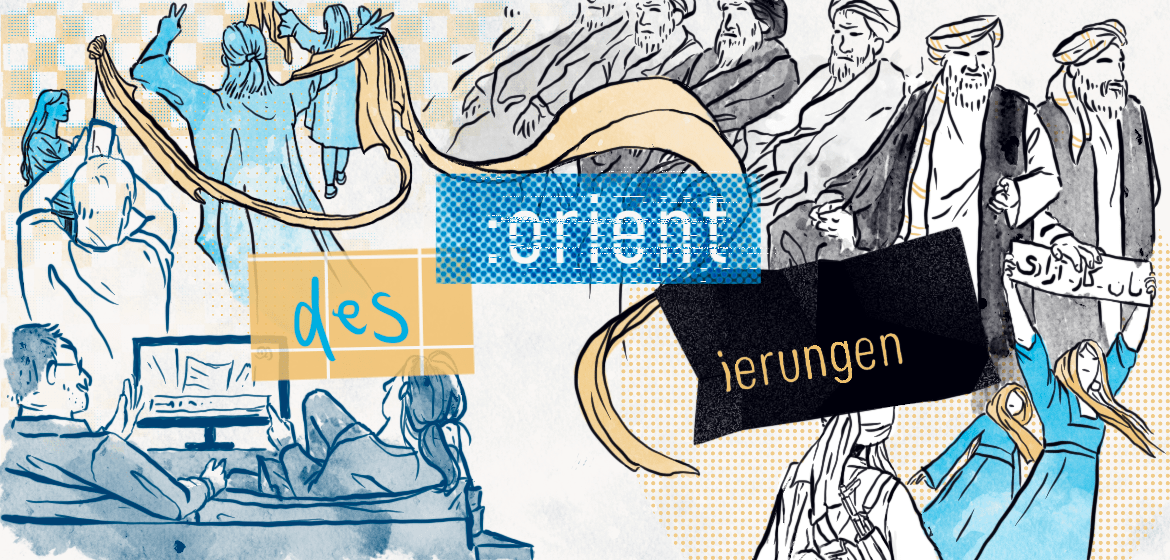Die Proteste in Iran erfordern internationale Solidarität. Doch damit auch Afghan:innen solidarisch sein können, müssen die Machtgefälle iranisch-afghanischer Beziehungen endlich offener besprochen werden, findet Mina Jawad.
Die Geschichte Afghanistans steht seit jeher in Verbindung mit der Geschichte des Iran. Beide Länder teilen sich ein gemeinsames kulturelles Erbe, Migrationsströme prägten beide Geographien. Eine besondere Zäsur: Im Zuge des „Kalten“ heißen Krieges suchten Afghan:innen ab den 1970er-Jahren verstärkt Zuflucht im Nachbarland vor Krieg und Verfolgung. Seit über 40 Jahren leben daher Menschen aus Afghanistan in Iran, nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks sind ca. 780.000 offiziell registriert, die Dunkelziffer wird sogar auf über drei Millionen geschätzt.
Diese starke Verbindung der Menschen beider Länder ist jedoch bei weitem nicht frei von Konflikten und Machtgefällen, denn Afghan:innen sind in Iran seit Jahrzehnten einem erheblichen Rassismus ausgesetzt: Einbürgerungen sind nicht möglich. Afghan:innen dürfen sich nicht in allen Teilen des Landes aufhalten. Vom Kauf einer Simkarte, über die Eröffnung eines Bankkontos bis zum Erwerb von Land sind sie überall mit Verboten konfrontiert. Kinder undokumentierter afghanischer Geflüchteter durften bis 2015 noch nicht einmal die Schulen besuchen. So waren es faktisch nur die Feigenblätter der Regierung, denen Bildung zuteilwurde.
Neben diesen strukturellen Diskriminierungen gehört auch gesellschaftliche Erniedrigung und Willkür zur Tagesordnung, insbesondere für Hazaras, die die größte Gruppe der Afghan:innen in Iran bilden. Aufgrund ihres ost-asiatischen Phänotyps unterscheiden sie sich, anders als die meisten anderen Afghan:innen, sichtbar von der Mehrheit der iranischen Bevölkerung und sind dadurch täglichen rassistischen Beleidigungen ausgesetzt. Gehälter werden einbehalten, man wird im Geschäft nicht bedient. Der Rassismus ist so weit verbreitet, dass in der Episode einer Fernsehserie die iranische Protagonistin damit bestraft werden sollte einen Hazara, also einen „stereotypen Afghanen“, zu heiraten. Wer als Afghan:in nicht als Hazara gelesen wird, versucht sich die lokalen Dialekte anzueignen und beispielsweise durch das Kaufen von Ausweispapieren verstorbener Iraner:innen dem Rassismus zu entgehen.
Fatale Vergleiche
Dieser Rassismus setzt sich nun auch in der internationalen Berichterstattung zu den aktuellen Protesten in Iran und den globalen Solidaritätsbewegungen subtil fort. Iran-stämmige werden dabei im Vergleich zu Afghan:innen häufig als „integrierter“ und „westlicher“ dargestellt: Iran ging aus einer historischen Hochkultur hervor, in Afghanistan werden Buddah-Statuen gesprengt. Kein Wort darüber, dass beide Länder sich das Erbe teilen und aus vielerlei Gründen nicht vergleichbar sind. Die urbane Bevölkerung des Iran macht 70% aus, in Afghanistan entspricht das dem Anteil der Landbevölkerung. Ganz zu schweigen von 40 Jahren Krieg in Afghanistan. So erhält die rassistische Rhetorik der „unziviliserten“ Afghan:innen im Verhältnis zu Iraner:innen weiter Aufwind.
Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet die amerikanisch-iranische Journalistin und bestens mit dem State Department vernetzte Masih Alinejad von der New York Times sprichwörtlich zum Gesicht der Proteste erkoren wurde. Alinejad tritt immer wieder mit Vergleichen zwischen den iranischen Mullahs und den afghanischen Taliban auf. Derlei Vergleiche haben jedoch einen rassistischen Kern, der in der medialen Berichterstattung meist unthematisiert und unsichtbar bleibt: Die Taliban sollen als Maßstab von Barbarei die missliche Lage der Bevölkerung Irans unterstreichen, damit es auch ja alle verstehen. Afghanistan muss dabei als Vergleich „nach unten“ herhalten, wodurch die bereits bestehenden Hierarchien und Rassismen zwischen den Ländern weiter vertieft werden.
Wie Afghan:innen selbst den Taliban Widerstand leisten, wird dabei meist außer Acht gelassen. Stattdessen wurde afghanischen Männern immer wieder unterstellt, dass sie die Taliban durch ihren vermeintlichen Kampfesunwillen erst an die Macht gebracht haben. Wie sich die Menschen, gerade auch die afghanischen Frauen, tagtäglich gegen die Taliban wehren und was ihre Forderungen sind, wird von der internationalen Berichterstattung und Exil-Iraner:innen selten miteinbezogen. Statt Anknüpfungspunkt für gemeinsame Kämpfe zu sein, werden afghanische Perspektiven häufig unsichtbar gemacht und negiert.
Koloniale Enthüllungsphantasien
In ihren Äußerungen bedient sich Alinejad zudem des Narratives, dass Frauen vom Kopftuch befreit werden müssen – und dass die „westliche Lebensweise“ sie retten könne. Zwar widersprechen dieser Lesart auch viele Exil-Iraner:innen und betonen, dass es mehr als nur um die Selbstbestimmung der Frauen gehe. Dennoch darf nicht übersehen werden, wie derart vereinfachende Darstellungen neokolonialen Überlegenheitsfantasien im globalen Norden weiter Aufwind geben können.
Denn der globale Norden interessiert sich nicht für Selbstbestimmung, er hat Interessen. Und so wird angeblicher Feminismus schnell imperial missbraucht. Ein Umstand, der insbesondere Afghan:innen sehr schmerzlich bewusst ist, war doch die Invasion Afghanistans in Folge von 9/11 vermeintlich ebenfalls in „ihrem Interesse“. Auch diese historischen Erfahrungen von Afghan:innen müssen stärker berücksichtigt werden, damit anti-koloniale und feministische Kämpfe nicht gegeneinander ausgespielt werden. Denn sonst passiert es schnell, dass weiße Europäer:innen sich legitimiert fühlen, den „zivilisierten“ Iraner:innen Aufmerksamkeit für ihre feministischen Kämpfe zu schenken, ohne sich grundsätzlich von ihren anti-muslimischen und neokolonialen Ressentiments verabschieden zu müssen.
Diese gefährlichen Implikationen von Afghanistan-Vergleichen müssen gerade jetzt, während der andauernden Proteste in Iran, mitgedacht werden. Dass dafür keine Zeit sei, weil nun erstmal eine „Front gegen die Mullahs“ gebildet werden müsse, ist zu kurz gedacht. Denn auch während Menschen Widerstand leisten, dürfen sie nicht aufhören, über Privilegien nachzudenken und sich diesen zu stellen. Und schließlich sind von den Protesten sowieso nicht nur die Iraner:innen, sondern auch die afghanischen Geflüchteten im Land unmittelbar betroffen.
Keine Opferolympiade
Dass wir als Afghan:innen über Rassismuserfahrungen oft geschwiegen haben, ist Ausdruck von Höflichkeit und Respekt vor den Protesten, aber auch die Sorge vor Gaslighting. Wir haben Angst, dass uns unsere Diskriminierungserfahrungen abgesprochen werden und stattdessen ein Vorwurf mangelnder Solidarität und Verständnisses für die Kämpfe der Menschen in Iran unterstellt wird. Iraner:innen mögen im Verhältnis zu Afghan:innen vom diesem globalen Rassismus profitieren. Aber sie sind auch selbst betroffen. Es kann nicht in ihrem Interesse sein, sich einer Fetischisierung hinzugeben.
Es geht nicht darum, den Menschen in Ost-Kurdistan und in Iran die Solidarität zu entziehen und sich in eine „Opferolympiade“ zu begeben, wer nun von schlimmerer Diskriminierung und Unterdrückung betroffen ist. Es geht darum, Grabenkämpfen entgegenzuwirken und die Grundlage für echte Solidarität und Verschwesterung zu schaffen. Dafür müssen sich vor allem Iraner:innen, ihren internalisierten Rassismen stellen und aktiv entgegenwirken.
Falls hingegen kein Interesse, oder angeblich keine Zeit und Ressourcen dafür bestehen, die diese Bedenken und Erfahrungen zu hören, braucht man sich nicht zu wundern, dass unsere Solidarität zwar weiter für die Menschen in Iran gilt, die sich gegen staatliche Gewalt wehren. Sie kann dann aber über den Kampf gegen den unterdrückerischen Staat nicht hinausgehen und Teil einer Bewegung werden, solange diese uns und neokoloniale Fallstricke nicht mitdenkt.
Unsere Tür steht offen, denn an dieser Diskussion führt kein Weg vorbei.
Mehr Arbeiten der Illustratorin Zaide Kutay finden sich auf ihrem Instagram-Account.