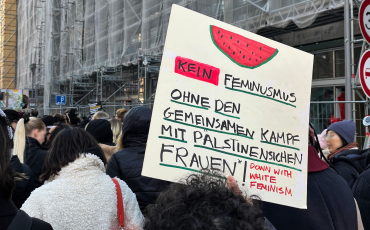Die deutsche Öffentlichkeit streitet sich oft über das richtige Verhältnis zu Israel. Die tatsächliche Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen wird dabei außer Acht gelassen.
Dieser Text ist Teil des Dossiers „Deutsche Außenpolitik in WANA“. Alle Texte des Dossiers finden sich hier. Das Projekt wurde durch das Grow-Stipendium von Netzwerk Recherche e.V. und der Schöpflin Stiftung gefördert.
Wenn in der deutschen Politik über Israel geredet wird, geht es um Erinnerung und Identität. Beispiele dafür gibt es viele, besonders deutlich wurde das in einer Bundestagsdebatte zum 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung im April 2018.
Dort erklärte Martin Schulz für die Sozialdemokraten: „Indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst – vor den Dämonen unserer eigenen Vergangenheit.“ Katrin-Göring Eckhardt von den Grünen kristallisierte die Debatte im Ausspruch, dass „das Existenzrecht Israels unser eigenes“ sei.
Die grundsätzliche Stabilität der Beziehungen mit Israel gilt als Gradmesser dafür, wie weit sich Deutschland von seiner barbarischen Vergangenheit entfernt hat. Dass Israels Sicherheit deutsche „Staatsräson” ist, wie Angela Merkel 2008 vor der Knesset, dem israelischen Parlament, zusicherte, ist mittlerweile fester Bestandteil der bundesdeutschen Identität.
Interessanterweise wird über eines nicht geredet, wenn es um das deutsche Israelverhältnis geht. Nämlich über die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen selbst. Also über die Frage, warum Bundesrepublik und Israel ehedem Beziehungen aufgenommen haben, was das beidseitige Verhältnis bestimmte und wie es sich über die Zeit wandelte.
„Ansehen unter den Völkern gewinnen“
Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel gehen zurück auf das Reparationsabkommen von 1952, in dem sich Deutschland, so die brutale Wortwahl, zur „Wiedergutmachung“ verpflichtete.
Warum kam das Abkommen zustande? Sicher nicht aus moralischen Gründen oder durch ein „Wunder der Versöhnung“, beliebten Erklärungsmustern des heutigen deutschen Diskurses.
Die Rede von der Moral überzeugt alleine deswegen schon nicht, weil die frühe Bundesrepublik noch stark von der unmittelbaren NS-Vergangenheit geprägt war. Täter*innen und Mitläufer*innen stiegen in höchste Ämter der staatlichen Institutionen auf und gehörten weiterhin zur gesellschaftlichen Elite. Dass weite Teile der Bevölkerung die Barbarei mitgetragen hatten, wurde verschwiegen.
Konrad Adenauer, der erste Kanzler der BRD, erklärte die deutschen Beweggründe ganz offen im ZDF, in einem Anfang 1966 ausgestrahlten Interview mit Günter Gaus. Befragt zu seiner Reparationspolitik sage er:
„Wir hatten den Juden so viel Unrecht getan, wir hatten solche Verbrechen an ihnen begangen, dass sie irgendwie gesühnt... oder wiedergutgemacht werden mussten, wenn wir überhaupt wieder Ansehen unter den Völkern der Erde gewinnen wollten.“ Dann fügte er hinzu: „Die Macht der Juden auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen.”
Die Reparationszahlungen waren für Adenauer also weniger ein Gebot der Moral als ein Mittel, den Ruf Deutschlands wiederherzustellen. So weit, so wenig überraschend. Überraschender ist aus heutiger Sicht der antisemitische Verweis auf die „Macht der Juden” und das entlarvende „auch heute noch”.
Adenauer war zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben ein Nazi gewesen. Das macht die Sache aber nicht besser – im Gegenteil ist es umso interessanter, dass jemand wie Adenauer noch im Jahre 1966 ganz selbstverständlich vor der deutschen Öffentlichkeit das Reparationsabkommen mit „deutschem Ansehen” und „jüdischer Macht” begründete.
Kein Wunder: Die deutsche Aufbauhilfe für Israel
Aber warum hat der jüdische Staat, in dem so viele Überlebende des deutschen Horrors Obdach fanden, die Hand der kaum entnazifizierten BRD ergriffen? Was auf menschlicher Ebene undenkbar war, nämlich Absolution zu erteilen, war aus staatlicher Perspektive naheliegend.
Nicht Vergebung oder Versöhnung, sondern blanke materielle Not trieben den jungen jüdischen Staat Richtung Bundesrepublik. Unmittelbar nach Staatsgründung war Israels Überleben keineswegs garantiert. Der Staat glich einem Experiment mit ungewissem Ausgang, die nächste Kriegsrunde mit den arabischen Nachbarstaaten schien nur eine Frage der Zeit.
Unter diesen Bedingungen war das Reparationsabkommen, wie Israels Chefunterhändler Nahum Goldmann bezeugte, „eine Rettung“. Denn mit diesem Abkommen verpflichtete sich die Bundesrepublik zunächst nicht zu Individualentschädigungen für Überlebende der Schoah in Israel oder anderswo, sondern zu einer massiven Wirtschaftshilfe für den bedrohten jüdischen Staat. Stahl, Maschinen, Transportschiffe und Geld für Öl aus britischen Raffinerien: all das war essentiell, um eine landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft zu industrialisieren und die vielen neuen jüdischen Einwander*innen aus WANA Ländern und den Displaced Persons (DP) - Lagern des Nachkriegseuropa in Lohn und Brot zu bringen.
Während die deutsche Aufbauhilfe für den israelischen Kleinstaat überlebenswichtig war, zahlte die Bundesrepublik einen Spottpreis für ihre moralische Rehabilitation. Die jährlichen Lieferungen an Israel überstiegen nie 0,2 Prozent des Bruttosozialprodukts. Sie belasteten die deutsche Wirtschaft nicht, sondern kurbelten im Gegenteil die Exportindustrie an.
Wie Tom Segev in seinem aktuellen Buch beschreibt, war für Staatsgründer David Ben-Gurion kein Preis zu hoch, um Israel zu gründen und zu sichern. Doch es gab enorme Proteste gegen das „Blutgeld“. Die Reparationsfrage stürzte Ben-Gurion in die schwerste innenpolitische Krise der Gründungszeit.
Letzten Endes war seine Deutschlandpolitik aber zweifellos erfolgreich. Infolge des Reparationsabkommens entwickelten sich die deutsch-israelischen Beziehungen bis 1967 rasant. Zu den Reparationslieferungen gesellten sich schnell Waffen, Militärgüter und Finanzhilfen. All das trug entscheidend dazu bei, Israel von einem Sammelbecken verarmter Geflüchteter und Pionier*innen zu einer Regionalmacht zu machen.
Die erste Phase der deutsch-israelischen Beziehungen bis 1967 ist verworren, seltsam und folgenreich. Sie ist oft haarsträubend und zynisch, die deutschen Beweggründe teils antisemitisch geprägt. Sie darzustellen übersteigt die Grenzen dieses kleinen Beitrags.
In Israel wird die Geburtshilfe ausgerechnet durch Deutschland verständlicherweise nur ungern diskutiert. Aber auch in der Bundesrepublik wissen die Wenigsten über die essentielle Rolle Bescheid, die die BRD für Israel in seiner Anfangszeit gespielt hatte.
Fast Forward: Identität und Israelpolitik heute
Was für Regierung und Parlament gilt, gilt auch für die weitere Gesellschaft. Wenn in Deutschland über Israel geredet wird, wird vor allem über Deutschland geredet.
Aktuell ist das besonders sichtbar in der Debatte um die Antisemitismusvorwürfe gegen den postkolonialen Theoretiker Achille Mbembe, die maßgeblich seitens des Bundesbeauftragten für Antisemitismus, Felix Klein, erhoben worden sind. In der Auseinandersetzung darüber, wie sich ein kamerunischer Philosoph zur deutschen Vergangenheit und zu Israel zu verhalten hat, erheben Kritiker*innen Mbembes Anspruch auf die Universalität deutscher Erinnerungskultur.
Verteidiger*innen des postkolonialen Theoretikers sehen in eben diesem Anspruch, das Partikulare universalisieren zu wollen, eben das Provinzielle deutscher Erinnerungskultur. Beide Pole der Debatte (es gibt noch mehr) verhandeln die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Zivilisationsbruch der Schoah. Die Aufgeregtheit und Härte der Debatte zeigt, dass sie in der Nahkampfzone deutscher Identitätspolitik geführt wird.
Die Debatte über das „richtige“ Israelverhältnis in Deutschland ist projektionsgesteuert. Rechts, links und in der Mitte. Verhandelt werden Erinnerung und Identität – was eine nüchterne Diskussion über Außenpolitik erschwert.
Stephan Detjen, Chefkorrespondent des Deutschlandfunks, schreibt in der FAZ vom 24. Juni, dass sich das „politische Umfeld” der Mbembe-Debatte „weiter aufheizen” dürfte, „wenn die israelische Regierung mit der Ankündigung ernst macht, das Westjordanland förmlich zu annektieren.” Die Frage über „Reaktionen auf deutscher und europäischer Ebene wird Trittsicherheit in der Argumentation erfordern. Die deutsche Politik aber ist schlecht darauf vorbereitet.”
Nun hat die Annexion von ungefähr einem Drittel des Westjordanlandes, angekündigt für den 1. Juli, vorerst nicht stattgefunden. Vom Tisch ist sie damit nicht. Innenpolitisch ist die Annexionsankündigung ein Wahlkampfmittel für Premierminister Netanyahu, außenpolitisch ist ihre Realisierung abhängig von der Frage, ob ab dem nächsten Herbst der Donald Trump oder der annexionsaverse Joe Biden das Weiße Haus bezieht.
Wie verhält sich Deutschland zu der aktuellen Entwicklung? Am 10. Juni besuchte Außenminister Heiko Maas Israel. Er war nach dem US-Amerikaner Mike Pompeo der zweite Außenminister, der den Staat nach der letzten Neuwahl und dem Corona-Lockdown besuchte. Erst die USA, dann Deutschland: Das spiegelt die Rangfolge der wichtigsten Verbündeten Israels seit Mitte der 60er Jahre wider. In Europa ist Deutschland Israels wichtigster Partner und Fürsprecher.
Maas, der auf einen Besuch des Westjordanlands verzichtete, sprach sich auch in Israel strikt gegen die Annexion von Teilen des Westjordanlandes aus. Das war erwartbar. Das Pochen auf Völkerrecht gehört zum rhetorischen Standardrepertoire deutscher Außenpolitik. Zur Freude der Netanjahu-Regierung machte Maas aber auch klar, dass Deutschland im Gegensatz zu manch anderen europäischen Ländern Sanktionen gegen Israel nicht unterstützen werde. Auch das überrascht nicht.
Deutschland ist mit Israel zu eng verzahnt, politisch, wirtschaftlich, militärisch und auch kulturell. Diese Beziehungen werden die Bundesrepublik nicht aufs Spiel setzen, um die Idee eines palästinensischen Staates in den seit 1967 besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten. Wichtiger noch: Die Stabilität der Beziehungen mit Israel ist zum Anker der bundesdeutschen Identität nach dem Nationalsozialismus - und in Abgrenzung dazu – geworden.
Die Beziehungen Deutschlands zum jüdischen Staat werden auch weiterhin auf der Bühne der deutschen Erinnerungspolitik verhandelt werden. Das ist auch wichtig und richtig.
Aber vielleicht könnten die oft kreisförmigen Auseinandersetzungen um das deutsche Israelverhältnis an Selbsterkenntnis gewinnen, wenn sie anfangen würden, die tatsächliche Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen mitzudenken.