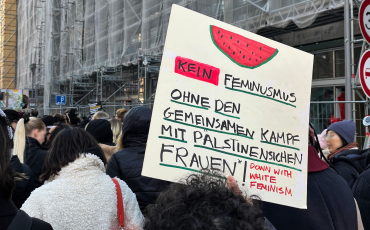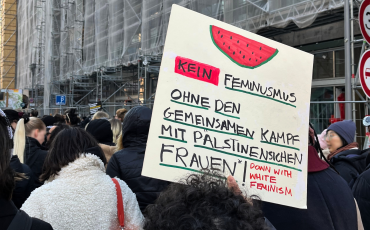Mit den arrivierten Mustern der politischen Auseinandersetzung ist neoliberaler Politik mittlerweile kaum mehr beizukommen. Die ökonomischen Rahmenbedingungen für Aktivismus zwischen Deutschland, Nordafrika und Westasien (WANA) erfordern neue, solidarische Verfahrensweisen – über kommodifizierte Wertigkeiten hinaus.
Zwei Fragen, eine klare Antwort: „Warum wurden die sozio-ökonomischen Missstände, die zu den populären Aufständen in der WANA-Region geführt haben, seither so konsequent heruntergespielt?“ Und: „Warum ist aus den sozio-ökonomischen Forderungen vieler Menschen bisher nichts geworden?“ Zum Auftakt von „Connecting Resistances“ beantwortete Angela Joya beide Fragen entschieden: neoliberaler Autoritarismus.
Was es damit auf sich hat, führte Joya in ihrer Keynote aus. Die Assistenzprofessorin für internationale Politik und Ökonomie an der University of Oregon beschrieb neoliberalen Autoritarismus dabei als politisches Transformationsprojekt. Ausgehend von Nordamerika und Westeuropa seien dessen Folgen in den Ländern Nordafrikas und Westasiens besonders markant: Unter der Prämisse des „freien Marktes“ veränderten sich dort nicht nur Produktions-, sondern auch Herrschaftsverhältnisse; um „wirtschaftliches Wachstum“ zu sichern, entstanden mächtige Allianzen zwischen Kapital und Staatsgewalt. Davon profitierten einige wenige nationale und internationale Akteure, während große Teile der Bevölkerung politischen Repressionen ausgesetzt seien. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe neoliberaler Autoritarismus daher zu wirtschaftlicher Not ebenso wie politischer Marginalisierung geführt.
Wie es im Detail dazu kommt und was dagegen konkret getan werden kann, haben die Teilnehmer*innen im Laufe der Konferenz ausführlich diskutiert. Die Beiträge verdeutlichen die ökonomischen Rahmenbedingungen für emanzipatorischen Aktivismus zwischen Deutschland und der WANA-Region. Einerseits belegen sie, wie schwierig es ist, neoliberalem Autoritarismus in der Auseinandersetzung für soziale Gerechtigkeit zu entkommen. Diese bittere Erkenntnis vermag andererseits aber auch die Richtung der nächsten Schritte von „Connecting Resistances“ vorzugeben – gerade, weil sie auf einer geteilten Erfahrung beruht.
Zwangsweise freiwillig
Im Anschluss an die einführende Keynote ergaben sich direkt spannende Gespräche. Im Mittelpunkt standen dabei die politischen Ökonomien in Ägypten, der Türkei, im Libanon und Marokko. Aus unterschiedlichen Richtungen wurde darüber diskutiert, was neoliberale Politik aktuell im „Kern“ ausmache – und darüber, welche Form der politischen Auseinandersetzung dabei möglich, welche nötig sei, wie es ein Vertreter von Attac Marokko formulierte.
Einzelne Teilnehmer*innen näherten sich diesen Themen aus historischer Perspektive: Worin, so eine Nachfrage, unterscheide sich neoliberaler vom populistischen Autoritarismus der 1960er, wo ergänzten sich gegenwärtig politische Repression und national-chauvinistische Rhetorik? Gibt es, wollte ein Teilnehmer wissen, anti-autoritäre Praktiken aus vor-neoliberaler Zeit, die progressive Politik auch heute noch inspirieren können?
Andere Beiträge beschrieben den expansiven Charakter neoliberaler Politik. Nicht nur breite sie sich geographisch immer weiter aus, sondern präge gleichzeitig das Selbstverständnis politischer Aktivist*innen. Die tiefgreifende Integration der WANA-Region in die Weltwirtschaft habe handfeste Konsequenzen: So führte Angela Joya in ihrer Keynote aus, dass es mittlerweile unmöglich sei, überhaupt außerhalb des kapitalistischen Systems zu arbeiten. Neoliberale Politik werde den Akteuren in der WANA-Region jedoch nicht mit Gewalt „von außen“ übergestülpt. Sie setze so galant Anreize zur Maximierung des persönlichen Profits, dass die Selbst-Disziplinierung bisweilen oft sogar zwangsweiße freiwillig funktioniere.

Aktivistische (Alb-)Träume
Einige Aktivist*innen gingen denn auch mit der „Vermarktung“ ihrer Arbeit hart ins Gericht. Neoliberale Politik, so der Einwand, beeinflusse ihre Strategien – und zwar so sehr, dass mitunter die klassistischen, rassistischen und sexistischen Hierarchien bestärkt würden, die es im Kampf für soziale Gerechtigkeit eigentlich abzubauen gelte. Zuletzt habe der soziale Status prominenter Aktivist*innen nämlich dazu geführt, (identitäts-)politische Ansprüche auf Selbstbestimmung auf Kosten sozioökonomischer Forderungen nach Umverteilung zu betonen. Die „Selbst-Regulierung neoliberaler Subjekte“ entpolitisiere dabei die Auseinandersetzung, weil anstelle des „Systems“ vor allem der persönliche Nutzen in Frage stehe.[1]
Vor diesem Hintergrund entfalten auch die marktkonformen Programme der internationalen „Entwicklungshilfe“ vollends ihren restriktiven Beitrag zum Status quo. Bei „gender empowerment“ zum Beispiel liege der Fokus vor allem auf der Vermittelbarkeit von Arbeitnehmer*innen, wie Teilnehmer*innen über die GIZ in Ägypten und EU-Projekte in Jordanien berichteten. Dagegen ist natürlich erst einmal nichts einzuwenden. Doch werden mit solchen Programmen oft eher bürokratische Boxen abgehakt, statt nachhaltige Veränderungen angestoßen – ganz zu schweigen von der „Partnerschaft“ oder gar Selbstermächtigung, die Akteure der internationalen „Entwicklungszusammenarbeit“ für ihre „Klienten“ vorsehen.
So kommt es, wie eine Teilnehmerin voller Befremden anmerkte, dass der „Aktivismus“ vieler junger Menschen sich mittlerweile darauf belaufe, aus eigenem Antrieb und oft unentgeltlich für Google oder die Vereinten Nationen zu arbeiten. Gleichzeitig würden, so berichtete eine Teilnehmerin über ihre Erfahrungen in Syrien, zahlreiche Initiativen durch internationale Geldgeber auf „humanitäre“ Hilfsmaßnahmen umgemünzt, wenn sie für zu „politisch“ gehalten werden. Für eine NGO zu arbeiten, sei daher auch nicht mehr zwangsläufig der ultimative Aktivist*innen-Traum. Zu sehr scheinen auch sie mittlerweile in den bürokratischen Mühlen, elitären Zirkeln und Bedürftigkeits-Hierarchien von neoliberaler Politik und rassifizierter „Nächstenliebe“ gefangen.
Ein libanesischer Teilnehmer brachte es auf den Punkt – betroffenes Schweigen und verhaltenes Grinsen vieler Teilnehmer*innen inklusive: „Die Dominanz gut ausgebildeter Menschen aus der Mittelschicht nimmt den NGOs ihre politische Schlagkraft.“[2] Deren Mitarbeiter*innen seien zwar oft hochqualifiziert, würden aber über keine produktive und gestalterische Kraft verfügen. „Wenn sie protestieren,“ so fügte er hinzu, „passiert nichts, außer dass ein paar Berichte und Anträge nicht geschrieben werden. Zu radikaleren Schritten trauen sie sich nicht, weil sie zu gut ausgebildet und privilegiert sind.“

Alte Foren ...
Einen unerwarteten Lichtblick gibt es vielleicht dennoch: Die selbstkritische Auseinandersetzung mit den Widersprüchen neoliberaler Politik kann nämlich neue Ansätze für politischen Aktivismus eröffnen. Dabei geht es insbesondere um Selbst-Organisation – und dafür ist die Klassenfrage zentral, aber anders als bisher.
Denn wie die Teilnehmer*innen der Konferenz zu bedenken geben, gelänge es nicht nur NGOs, sondern auch etablierten Foren politischer Repräsentation mittlerweile immer weniger, die Interessen marginalisierter Bevölkerungsgruppen zu vertreten. Das läge natürlich zu großen Teilen an der Gewalt, die von Regierungskreisen ausgeht: In der Türkei zum Beispiel bedrohten Zwangsenteignungen die Identität der kurdischen Bevölkerung ebenso wie deren Lebensgrundlagen. In Ägypten hätten Arbeiter*innenbewegungen zwar einen elementaren Beitrag zur Mobilisierung im Zuge der Aufstände der vergangenen Jahre geleistet. Mittlerweile würden (vormals unabhängige) Gewerkschaftsverbände aber von Staats wegen kooptiert. Im Libanon hätten dagegen die dezentral organisierten Proteste gegen die Müllkrise von 2015 offenbart, wie abseitig Gewerkschaften dort seien.
Doch auch Parteien begännen immer mehr archaischen Stammesverbänden zu ähneln, wie ein libanesischer Aktivist hinzufügte. Deren Mitglieder würden sich zunehmend abgrenzen, um ihre eigenen sektiererischen Interessen zu bewahren. Gleichzeitig scheiterten auch die sozialen Bewegungen der vergangenen Jahre daran, eine nachhaltige demokratische Vertretung und institutionelle Einflussnahme aufzubauen – trotz aller symbolischen Vehemenz, wie der iranisch-amerikanische Soziologe Asef Bayat deren größtes „Paradox“ zusammenfasst.[3]
... und neue Klassen?
Was also ergibt sich daraus? Vielleicht, so eine Teilnehmerin, ist es an der Zeit, die altehrwürdigen Kategorien von Arbeiter*innen, Gewerkschaften und Klassen zu überdenken. Aufgrund neoliberaler Politik bilde sich schließlich vielerorts eine neue „Klasse“ heraus, nämlich die des Prekariats.
Diese Klasse, wie der britische Ökonom Guy Standing herausgearbeitet hat, umfasst gut ausgebildete, junge Akademiker*innen, die Arbeit suchen, ebenso wie ältere Arbeitnehmer*innen, deren Anstellung bedroht ist. Trotz unterschiedlichen symbolischen und materiellen Kapitals – und das ist das Besondere daran – ist ihnen eine tiefgreifende Unsicherheit und Zukunftsangst gemein. Denn während Sozial- und Transferleistungen zunehmend abgebaut werden, steigen die Erwartungen an Selbst-Verantwortlichkeit, Flexibilität und Formen der Selbstausbeutung. Das trägt zu einem Gefühl der anhaltenden Überforderung ebenso wie einer verschärften Konkurrenzsituation bei. Bisher, so merkte eine türkische Teilnehmerin jedoch an, habe sich diese „prekäre Klasse“ ihrer gemeinsamen Situation noch nicht vergewissert. Auch ein kollektives Bewusstsein sei noch nicht entstanden.
Der Austausch, den „Connecting Resistances“ über unterschiedliche Lebenssituationen und -umstände hinweg ermöglicht hat, kann ein erster Schritt in diese Richtung sein.
Los geht es damit, „den“ Neoliberalismus nicht größer zu machen, als er ist. Sicherlich beeinflusst er viel, aber eben nicht alles – und das wiederum weder zwangsläufig noch einheitlich. Eine kritische Auseinandersetzung mit den ökonomischen Rahmenbedingungen für politischen Aktivismus kann daher andere Bezugsrahmen eröffnen – und zwar gerade jenseits kommodifizierter Wertigkeiten.
Dazu gehört, sich der vielen Faktoren zu vergewissern, die ein Miteinander ermöglichen, aber auch behindern. Große Reden verfangen dabei offensichtlich ebenso wenig wie pauschale Kritik an neoliberaler Politik. Stattdessen kämpfen immer mehr Menschen in der WANA-Region und darüber hinaus jeden Tag aufs Neue: für Selbstversorgung, Autonomie ebenso wie ihre Gemeinschaft. Geteilte Ökonomien und Ökologien also als konkrete Antwort auf immer knapper werdende, an harsche Bedingungen geknüpfte Ressourcen. Das hat Potential, muss aber unterstützt werden.
Zeitgemäßer Aktivismus, so der Tenor von „Connecting Resistances“, beschäftigt sich daher nicht nur mit den antiquierten Kniffen der Politik internationaler Finanzinstitutionen. Er versucht auch praktische Ansätze für Nahrungsmittelsouveränität, soziales Wohnen, zukunftsgerechter Arbeit und demokratische Digitalisierung beizutragen – egal ob in den besetzten Gebieten Syriens, in Golfmonarchien oder deutschen Großstädten. Nur so können tradierte politische Vorstellungen und Erzählungen umgestoßen, aber auch neue Verfahrensweisen der politischen Auseinandersetzung und Beteiligung etabliert werden.
[1] Das jüngst erschienene Buch „Not Enough. Human Rights in an Unequal World“ von Samuel Moyn, http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737563
[2] Arundhati Roy, „NGO-ization of resistance“, https://beautifulrising.org/tool/the-ngo-ization-of-resistance
[3] Ein interessantes Interview mit Asef Bayat über sein Buch „Revolutions without Revolutionaries“, https://madamasr.com/en/2018/02/03/feature/politics/revolution-without-revolutionaries-making-sense-of-the-arab-spring/