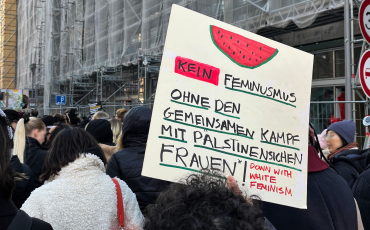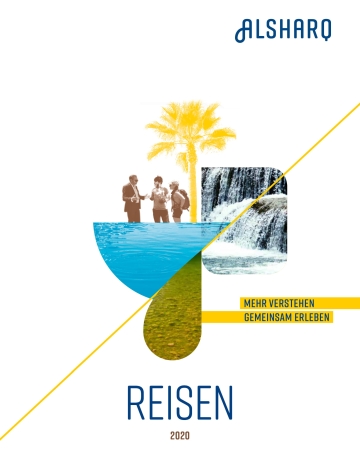Auf der „Academia Under Attack“-Konferenz in Hamburg wurde intensiv über Gaza, die Militarisierung Deutschlands und deutscher Institutionen sowie sich verschärfende Repressionen diskutiert. dis:orient war vor Ort.
Student:innen und Beschäftigte aus ganz Deutschland tummeln sich im Hörsaal am Von-Melle-Park an der Uni Hamburg. Als Golnar Sepehrnia vom Referat Internationaler Studierender (RIS) ans Pult tritt, legt sich das Gewusel. Ihre Worte sind bestimmt und klar. Sie vergleicht die Konferenz, die einen klaren Fokus auf Gaza hat, mit den Anfängen der Proteste gegen den Vietnamkrieg. Sie richtet sich vor allem gegen die deutsche Aufrüstung, denn „wer Kriege beenden will, muss ‚Frieden‘ aussprechen“.
Vom 12.-13. April, fand in Hamburg die ausgebuchte “Academia Under Attack”-Konferenz statt. Über zwei Tage hinweg wurde über den Genozid in Gaza und deutsche außen- sowie innenpolitische Entwicklungen diskutiert, organisiert vom RIS, und unterstützt von studentischen Ausschüssen, Students for Palestine, Allianz für Kritische und Solidarische Wissenschaft (KriSol) und dem Orient-Institut Beirut (OIB). Im Interview teilen die Pressesprecher John Lütten und Jan Wilkens mit, dass es schon lange die Idee für eine solche Konferenz gab. Nach einem Kennenlernen bei den Campus-Protesten in Solidarität mit Gaza vernetzten sich Angehörige der Uni Hamburg. Im Herbst 2024 sei dieser Gruppe klar geworden, dass man öffentlich in Erscheinung treten wolle, um Raum für eine Diskussion zu Gaza und den Verknüpfungen zur deutschen Politik zu bieten.
Lütten weist außerdem darauf hin, dass ein Bekenntnis zur internationalen Solidarität mit den Kolleg:innen und Kommiliton:innen in Gaza, sowie ihren Institutionen, viel zu spät käme. Alle Hochschulen wurden mittlerweile Ziel israelischer Angriffe, viele Mitarbeiter:innen und Angehörige vom israelischen Militär ermordet. Die in Deutschland mit dem Genozid in Gaza verbundenen Themen Wissenschaftsfreiheit und Militarisierung hingegen seien aktueller und drängender denn je. Und dennoch sei es wichtig auf einen Wiederaufbau palästinensischer Wissenschaftsstruktur hinzuarbeiten – hier sehen Lütten und Wilkens die deutschen Universitäten in der Verantwortung.
Bezogen auf die Kriege der letzten Jahre sei nun klar geworden, dass humanitäre Anliegen nicht von Regierungen verwirklicht würden – Menschen müssten selbst füreinander einstehen, so Sephernia. Für diese Worte erntet sie lauten, schallenden Applaus.
Die Einführung wird von John Lütten fortgesetzt, der weniger Mitleid und mehr aktive und produktive Solidarität fordert. Michael Barenboim und Laila Prager von der Association of Palestinian and Jewish Academics kritisieren die Zustände an deutschen Unis, zuletzt die Absagen von Veranstaltungen mit der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese, und betonen, wie wichtig das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) für ein stabiles Bildungssystem in Palästina sei. Der emeritierte Politikwissenschaftler und ehemalige Bundestagspolitiker Norman Paech spricht sich für eine dezidiert pazifistische Perspektive aus: keine Waffenlieferungen und Unterstützung der Boykott-Bewegung BDS. Außerdem müsse die Wissenschaftsfreiheit insbesondere in Fällen wie dem von Albanese verteidigt werden, „viele genießen sie [die Wissenschaftsfreiheit] einfach, ohne für sie einzustehen“.
Scholasticide
Das erste Panel thematisiert die Zerstörung der Bildungsinstitutionen in Gaza durch die israelische Armee. Nachdem Wesam Amer den Begriff Scholasticide als gezielte Zerstörung von Bildungsstätten erklärt und auf die durch den Gaza-Krieg in starke Mitleidenschaft gezogene Reputation Deutschlands hinweist, wird eine Videoschalte zu Asma Mustafa, einer Englisch-Lehrerin in Gaza, eingerichtet. Sie spricht von einer großen Leinwand aus zu den Anwesenden: Bereits im November 2023 begann sie wieder mit dem Unterricht. Heutzutage gebe es nicht mehr viele aktive Lehrer:innen, sie selbst betreue teilweise 250 Kinder zur selben Zeit. „Ich werde meine Kinder niemals verlassen“ sagt sie dem Publikum, nur unterbrochen durch spontane Ausbrüche von Applaus. Ihre Tafel habe sie von Gaza-Stadt nach Rafah, nach Deir el-Balah und schließlich Khan Younis mit sich getragen. Sie spricht hoffnungsvoll, aber müde und betont: „Gazas Kinder sind keine Kinder mehr“.
Die Schilderungen des Leids ihrer Schüler:innen untermauert der Bildungsforscher Yusuf Sayed mit einem Bericht zur Situation palästinensischer Bildung. Sayed und sein Team konnten nachweisen, dass über 92 Prozent aller Schulen beschädigt oder vollständig zerstört wurden. Die Zahlen zeigen: so gut wie jedes Kind in Gaza hat bereits Todesfälle in der Familie erlebt und ist durch ständige Bombardierungen und Vertreibungen von Traumata betroffen.
Literaturwissenschaftlerin Sabine Broeck schließt das Panel und damit den thematischen Bogen zu Deutschland: Sie setzt sich mit der Positionierung der deutschen Wissenschaft auseinander und wirft die Frage auf, inwiefern inmitten des andauernden Genozids das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Israel noch immer als einen „Wertepartner im Nahen Osten“ bezeichnen kann. Sie kritisiert außerdem den fehlenden Aufschrei aus der breiten deutschen Wissenschaftscommunity über die Attacken auf ihre palästinensischen Kolleg:innen.
Fehlende Solidarität, Selbstzensur oder Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit?
Den möglichen Gründen für die Stille und damit der „Akademischen Freiheit in der autoritären Wende“ widmet sich das nächste Panel. Der Historiker Arne Andersen fängt mit der Entwicklung verschiedener Antisemitismus-Definitionen und deren politischer Instrumentalisierung an: vom 3D-Test von Sharansky über die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) bis zur Jerusalem Declaration on Antisemitism, kurz: JDA. Daran schließt die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann an; als Mitglied der Steuerungsgruppe der JDA betont sie die Positionierung der JDA im Kontext verschiedener Definitionen im größeren Kampf gegen Rassismus. Das solle nicht trivialisieren, sondern einen Rahmen schaffen, in dem Antisemitismus zu verorten sei. Sie sieht ihre Arbeit darin, einen multiperspektivischen Blick auf Geschichte, Erinnerung und Narrative zu ermöglichen – dieser gehe im deutschen Kontext häufig unter.
Diesen Blick sollten deutsche Universitäten stärker fordern und fördern, so Dörthe Engelcke und Margarita Tsomou von KriSol. Seit Jahren hätten Dozent:innen unpolitische Student:innen bemängelt – jetzt gebe es eine so starke Politisierung der Hochschulen, und auf einmal würde mehr „Objektivität“ gefordert. Für beide ein starker Widerspruch. Sie betonen auch die Notwendigkeit eines Einstehens für akademische Freiheit, denn die Diskussion um Antisemitismus nehme in der aktuellen Debatte um Palästina und Israel häufig die Form eines allgemeinen politischen Gesinnungstest an. Dies führe häufig zu Repressionen, auf die sie mit Zusammenhalt und Vernetzung antworten: in einem zweiten Schritt stellten sie erprobte Techniken des Zusammenhalts und der Vernetzung vor. Viele schreiben mit – Repressionen, und die Angst davor, sind für viele ein präsentes Thema.
Journalismus, der wegschaut und Wissenschaft, die einseitig fokussiert ist
Der Sonntag startet mit einem Panel zur deutschen Berichterstattung über Gaza seit Ende 2023: Riad Othman von medico international beklagt, dass häufig Fehlinformationen in der deutschen Presse aufkämen, die auch nachträglich nicht korrigiert würden. Außerdem gäbe es eine starke Tendenz, israelische Attacken nicht zu benennen. Diese Stille sieht Othman sogar, wenn israelische Täter:innen sprechen: So wurde auch der Bericht israelischer Soldat:innen über den Gaza-Krieg 2023-2024, oder ein Bericht über Beschäftigte im Gesundheitssektor in Gaza in Deutschland nur selten erwähnt. Zahlen und Berichte seien verfügbar, Othman attestierte großen Teilen der deutschen Medienlandschaft aber ein Verschweigen dieser Quellen.
Journalist Hanno Hauenstein beschreibt die deutsche Presselandschaft als völlig fixiert auf ein utopisches Ziel der vermeintlichen „Objektivität“. Dieses Ziel beschreibt er mit: „objectivity is a beautiful idea that does not exist“.
Im letzten Panel geht es um das Thema der wissenschaftlichen Zusammenarbeit für gerechten Frieden. Jens Hanssen, seit letztem Jahr Direktor des OIB, spricht von vielseitigen Attacken auf die Wissenschaftsfreiheit: Aus der Luft, durch Israel, aus den Medien, durch Deutschland. Dazu veröffentlichte sein Institut einen Beitrag zur Wissenschaftsfreiheit. Er fordert eine „Solidarität im Solidaritätsverständnis der Solidaritätssuchenden“ – eine tatsächliche Unterstützung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientiere. Diese Unterstützung wird von Beschäftigten an Gazas Universitäten seit über einem Jahr öffentlich gefordert. Hanssen wünscht sich auch mehr Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen aus Westasien, das sei aktuell aber nur beschränkt möglich: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die größte öffentliche Drittmittelgeberin Deutschlands, fördert nur Kooperationsprojekte mit Bezug auf „Nahost“, die eine israelische Kooperation miteinbeziehen. Hanssen erklärt, dass diese Vorgaben a priori Syrer:innen und Libanes:innen staatsrechtlich ausschließen. Es müsse mehr Forschungsprojekte mit breiteren Vorgaben geben, die vielfältige wissenschaftliche Kooperationen ermöglichen.
An diesem Wochenende wird aus vielen Perspektiven kritisch und offen vorgetragen, nachgedacht und gestritten. Diese Vielseitigkeit findet sich auch im Abschlussstatement der Konferenz. Wie Golnar Sepehrnia zu Beginn sagt: es ist zu hoffen, dass diese Konferenz einen Beitrag zur Beendigung des Genozids in Gaza leistet. Die Organisator:innen sind zuversichtlich, ein politisches Signal gesendet zu haben.