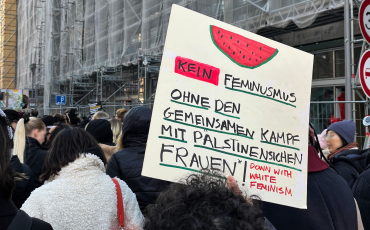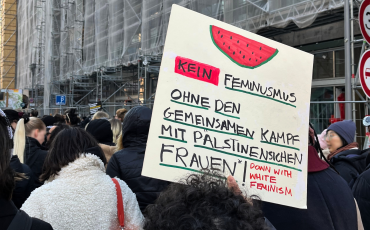Etwa 40.000 Geflüchtete aus Eritrea und Sudan leben in Israel, die meisten ohne Papiere und Perspektive. Die Regierung versucht seit Jahren, sie abzuschieben. Nun gab Premier Netanjahu bekannt, dass bis zu 16.000 von ihnen mittels eines UN-Abkommens in andere Staaten überführt werden sollten. Doch kurz darauf machte er einen Rückzieher.
Knapp 40.000 afrikanische Geflüchtete leben derzeit in Israel. Die meisten von ihnen kommen aus Eritrea und Sudan und leben im Süden Tel Avivs. Sie sind seit Mitte der 2000er Jahre vor dem Völkermord in Dafur und der eritreischen Diktatur geflüchtet. Manche flohen auch vor schlechten ökonomischen Verhältnissen.
Viele von ihnen haben sich zu Fuß über die ägyptische Sinai-Halbinsel durchgeschlagen, wo sich Entführungen und anschließende Lösegeld-Erpressungen in den letzten Jahren zu einem lukrativen Geschäft für die dort ansässige Beduinen-Stämme entwickelt haben. In Israel angekommen, berufen sich die meisten Geflüchteten auf die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die Israel unterschrieben hat. Doch der Aufenthalt der Ostafrikaner*innen im jüdischen Staat ist alles andere als ein Refugium. Denn Israel will diese Flüchtlinge nicht.
Schon seit mehreren Jahren gibt es Gerüchte, dass Israel versucht, Rückführungsabkommen mit Ruanda und Uganda auszuhandeln. Ende letzten Jahres wurden diese dann immer konkreter: Die beiden afrikanischen Staaten sollten einen Teil der ostafrikanischen Asylsuchenden in Israel, zunächst nur alleinstehende Männer, aufnehmen. 5.000 Dollar pro Flüchtling wurde den Drittstaaten für die Aufnahme angeblich zugesichert, die Geflüchteten selbst sollten 3.500 Dollar und ihren Flug erstattet bekommen. Wer nicht bis zum 1. April 2018 freiwillig ausreiste, sollte ausgewiesen werden. Bei Ausreiseverweigerung drohte Inhaftierung auf unbestimmte Zeit.
Nicht nur in Israel wurde vehement gegen diese Pläne demonstriert. Zahlreiche jüdische und nichtjüdische Menschenrechtsorganisationen, Aktivist*innen und Rabbiner*innen, viele von ihnen aus den USA, kritisierten die geplanten Abschiebungen. Auch vor den Botschaften Ruandas gab es in mehreren Staaten Proteste, unter anderem in Frankreich, Deutschland und Australien. Und die Jerusalemer Rabbinerin Susan Silverman rief sogar Israelis dazu auf, abschiebegefährdete Afrikaner*innen bei sich zu Hause zu verstecken.
Der internationale öffentliche Druck führte schließlich dazu, dass Ruanda bekannte, generell nur solche Asylsuchenden aus Israel aufzunehmen, die freiwillig einreisten. Diese Bedingung zur Durchführung der Abschiebungen war zuvor auch vom obersten Gerichtshof Israels genannt worden. Ein Anschein von Freiwilligkeit war jedoch kaum aufrecht zu erhalten, nachdem Israel öffentlich nach Abschiebehelfer*innen suchte – Kampferfahrungen, so die Ausschreibung, seien für die Tätigkeit „von Vorteil“.
Mit steigendem Druck häuften sich die Dementis Ruandas und Ugandas darüber, dass es überhaupt ein konkretes Abkommen mit Israel über eine Aufnahme der Geflüchteten gäbe. Aufgrund zweier Petitionen stoppte der Gerichtshof die geplanten Abschiebungen Ende März dann zumindest vorerst.
Ein Abkommen, das keines war
Überraschend gaben Netanjahu und sein Innenminister Arje Deri dann am Ostermontag bekannt, parallel zu den Verhandlungen mit den afrikanischen Staaten ein Resettlement-Abkommen mit den Vereinten Nationen ausgehandelt zu haben. Rund 16.000 der asylsuchenden Ostafrikaner*innen sollten von anderen UN-Mitgliedsstaaten aufgenommen werden, allen voran Kanada, Italien und Deutschland. Die relativ große Anzahl der vermeintlich Umzusiedelnden übertraf, so erste Berechnungen, sogar die Anzahl derjenigen, die im Falle eines Deals mit Ruanda Israel verlassen hätten. Es schien, als sei dem Regierungschef ein überraschendes Manöver gelungen, mit dem Gegner*innen wie Anhänger*innen Israels restriktiver Flüchtlingspolitik zufrieden gestellt werden könnten.
Bei all der Freude war nebensächlich, dass die „Einigung“, von der Netanjahu sprach, bis dato nicht mehr war als eine fixe Idee: Das „Abkommen“ entsprach in Wirklichkeit einer Arbeitsgruppe auf UN-Ebene, die in den nächsten Jahren „Lösungen“ für ca. 16.000 Geflüchtete finden sollte. Von einem Deal, den Netanjahu seinen Wähler*innen vorgaukeln wollte, konnte also keine Rede sein. Entsprechend dementierten die von Netanjahu genannten Aufnahmestaaten prompt die Existenz einer solchen Vereinbarung – peinlich für Netanjahu, der zurückrudern und erklären musste, er hätte Deutschland und Italien nur als Beispiel für mögliche Aufnahmeländer genannt.
Die Euphorie der Aktivist*innen über den vermeintlichen Deal war aber ohnehin nur von kurzer Dauer: Denn noch am späten Montagabend verkündete der israelische Ministerpräsident auf Facebook, das Abkommen sei ausgesetzt. Am Dienstagmittag gab er dann auf einer Kundgebung im Süden Tel Avivs seine endgültige Abkehr vom UN-Plan bekannt.
Das Scheitern des UN-Deals hatte indes nur wenig damit zu tun, dass ein konkretes Abkommen von den Aufnahmestaaten dementiert worden war. Unter Druck, um das vorherige Scheitern der Abschiebe-Pläne mit Ruanda und Uganda bestmöglich zu kaschieren, der aufgeheizten internationalen Stimmung entgegenzukommen und gleichzeitig weiteren Streit mit dem obersten Gerichtshof zu vermeiden, hatte Regierungschef Netanjahu den Israelis eine schnelle Lösung präsentieren wollen und dabei die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Denn kaum hatte Netanjahu das vermeintliche Abkommen bekanntgeben, sah er sich dem Widerspruch seiner eigenen Regierung ausgesetzt. Zunächst positionierte sich Netanjahus Dauer-Rivale mit Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten, Naftali Bennett, der bekannte, man würde nach dem UN-Deal niemanden mehr überzeugen können, dass es sich nicht lohnen würde, illegal nach Israel „einzudringen“. Auch prominente Likud-Abgeordnete wie Tzipi Hotolevy oder der rechtsaußen-stehende Gideon Saar forderten die Rücknahme des Deals. Und auf Facebook, wo Netanjahu per Video versuchte, den UN-Plan vor seinen Anhänger*innen als Vernunftentscheidung zu bewerben, hagelte es Kritik. Die Basis war not amused – und Netanjahu machte einen Rückzieher.
Gesetze gegen „Eindringlinge“
Dabei war die Ablehnung des Deals durch Netanjahus rechte Wählerschaft absolut vorhersehbar: Abgesehen von einigen wenigen NGOs und Bürgerrechtsaktivist*innen innerhalb der linken Tel Aviver „Blase“, deren gesellschaftspolitische Haltung sich so oft von der des restlichen Landes unterscheidet und die in den letzten Jahren zahlreiche Aktionen und Demonstrationen zugunsten der Geflüchteten veranstaltet hatte, sind israelische Bürger*innen den afrikanischen Geflüchteten äußerst kritisch gegenüber eingestellt: Noch im Januar 2018 bekannten 66 Prozent der Israelis, Abschiebungen von asylsuchenden Eritreer*innen und Sudanes*innen in andere afrikanische Aufnahmeländer zu unterstützen.
Schon 2012 gaben knapp ebenso viele Befragte an, sich durch den Aufenthalt der Geflüchteten im Land gestört zu fühlen. In derselben Befragung stimmten auch 47 Prozent der Aussage der Knesset-Abgeordneten Miri Regev zu, die die Afrikaner*innen als „Krebsgeschwür im Körper Israels“ bezeichnet hatte.
Auf der israelischen Regierungsebene wird diese kritische Haltung allemal geteilt. Nicht erst seitdem die derzeitige rechtsnationale Koalitionsregierung von Premierminister Netanjahu im Frühjahr 2015 ihre Arbeit aufgenommen hat, wird mit Händen und Füßen versucht, die afrikanischen „Eindringlinge“, wie sie nicht nur im Volksmund, sondern auch in Gesetzestexten bezeichnet werden, loszuwerden.
Die israelische Asylpolitik für Geflüchtete aus Ostafrika ist dabei kaum als solche zu bezeichnen. Bis 2012 konnten die Geflüchteten kein Asyl beantragen, ihnen wurde lediglich zugesichert, nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden. Seit 2013 werden offiziell Asylverfahren durchgeführt, diese gelten jedoch als ineffizient und bürokratisch überladen. Die Anerkennungsrate für Asyl liegt bei weit unter einem Prozent: Seit 2013 haben genau zehn Menschen aus Eritrea Asyl in Israel erhalten, ebenso ein Sudanese.
Das israelische Vorgehen ist dabei äußerst ambivalent: Während die Asylsuchenden als schmarotzende Wirtschaftsflüchtlinge diffamiert werden, werden sie dennoch nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben – was bei einer Migration der Afrikaner*innen aus wirtschaftlichen Gründen nicht im Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention stünde. So wird deutlich, dass Israel allen öffentlichen Zuspitzungen zum Trotz zumindest implizit den Flüchtlingsstatus der Ostafrikaner*innen anerkennt und nicht offen mit dem Non-Refoulement-Prinzip der UN brechen will.
Dennoch verharren die Geflüchteten in Israel in einer Art Nimbus, ohne langfristige Perspektive: Sie werden zwar geduldet und israelische Arbeitgeber*innen können prinzipiell Geflüchtete einstellen, obwohl diese eigentlich keine Arbeitserlaubnis haben, so ein Urteil des obersten israelischen Gerichts. Ihre Aufenthaltserlaubnis müssen die Ostafrikaner*innen dennoch alle ein bis drei Monate erneuern – stets im Unwissen, ob einer Verlängerung stattgegeben wird oder sie stattdessen für bis zu ein Jahr ins Internierungslager Holot in die Negev-Wüste geschickt werden.
Verschiedene Ergänzungen der Gesetze zur „Vorbeugung von Infiltration“ von 1954, welche ursprünglich eingeführt worden waren, um die Rückkehr von Palästinenser*innen in israelische Gebiete zu verhindern, haben es dem israelischen Staat seit 2012 ermöglicht, neu eingetroffene Geflüchtete aus Ostafrika zuerst zu verhaften und dann zu internieren. Doch die Internierung kann bei dem Versuch, das Visum zu erneuern, jede*n treffen, auch diejenigen, die sich im jüdischen Ankunftsland bereits ein Leben aufgebaut haben, mit Arbeit und sozialem Umfeld. Der oberste Gerichtshof hat die zwei schärfsten Versionen dieser Gesetzesänderung gekippt. Statt wie ursprünglich vorgesehen drei Jahre dürfen Geflüchtete nun noch zwölf Monate am Stück inhaftiert werden – wohl ein schwacher Trost für alle Betroffenen.
Doch das derzeitige Asylsystem ist nicht nur menschenrechtlich fragwürdig, es ist auch außerordentlich ineffizient: Die Internierung in Holot ist aufwendig und teuer. Und das ist wohl der wahre Grund, warum Netanjahus Regierung sich in den letzten Jahren vermehrt bemüht hat, eine Möglichkeit zu finden, die Geflüchteten außer Landes zu bringen.
Machtspiele und Wankelmut
Vor diesem Hintergrund ist es geradezu bemerkenswert, dass der Ministerpräsident nicht in der Lage war, die ablehnende Reaktion seiner Basis vorherzusehen. Denn das Spiel mit den Medien und Emotionen seiner Basis ist eigentlich Netanjahus große Stärke, es ist die Grundlage seines Machterhalts. Seine offensichtliche Unfähigkeit, die Ablehnung des Deals durch seine Wähler*innen vorauszusagen, ist ein ungewöhnlich großer Fauxpas und zeigt, dass Netanjahu angeschlagen ist. Das ist auch nicht weiter verwunderlich: Der Premierminister sorgt sich derzeit um schwankende Umfragewerte und die anhaltenden Ermittlungen in verschiedenen Korruptionsverfahren.
Um eine politisch so kontroverse Entscheidung wie den UN-Deal gegen den Willen seiner Basis durchzuziehen, in der stetig nach rechts driftenden israelischen Gesellschaft, fehlte ihm ganz offensichtlich das Rückgrat. Den U-Turn und die damit implizierte Wankelmütigkeit nahm er dabei bewusst in Kauf. Es dürfte den Likud-Chef kaum überrascht haben, dass seine politischen Gegner*innen die Chance nutzten, Netanjahu gleich doppelt zu attackieren: Zunächst als Verbündeten linker NGOs, die Israel schaden wollten, und anschließend als haltlosen Taktiker ohne Rückgrat.
Dabei ist durchaus anzunehmen, dass die Kritik an Netanjahus Vorgehen durch Minister*innen und Likudkolleg*innen nicht rein ideologischer Natur ist. Denn mit ihrer heftigen Opposition gegen das Abkommen konnten Bennett und Co. im Machtspiel um politische Beliebtheit tatsächlich nur gewinnen: Zunächst einmal konnten sie wieder einmal zeigen, wer der wahre „Hardliner“ im israelischen Kabinett ist und sich als „Retter des jüdischen Staates vor den Eindringlingen“ präsentieren. Und gegenüber Netanjahus Zick-Zack-Kurs, der Wankelmütigkeit suggerierte und rechte wie linke Kommentator*innen gleichermaßen entsetzte, konnten sie Meinungsstabilität demonstrieren. Dass auch sie die Geflüchteten loswerden und am liebsten in ihre Herkunftsländer zurückschicken würden, steht dabei außer Frage.
Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
Ist der israelische Regierungschef also endgültig auf dem absteigenden Ast? Das ist zumindest zu bezweifeln. Auch in der Vergangenheit hat Netanjahu schon absurd anmutende Manöver hingelegt, die einem Politikwechsel um 180 Grad gleichkamen. Zu nennen wäre hier beispielhaft das Einknicken des Ministerpräsidenten in der „Klagemauer-Krise“ vergangenen Sommer, als Netanjahu nach anfänglichen Versprechungen einem gemischtgeschlechtlichen Gebetsabschnitt an der Klagemauer doch noch eine Abkehr erteilte, um seine ultraorthodoxen Regierungspartner nicht zu verstimmen. Langfristig geschadet haben ihm solche Manöver bisher nicht. Immer wieder schafft der Likudnik es, seine Basis mit einschlägigen politischen Parolen neu für sich zu gewinnen. Und nichts anderes als deren Unterstützung zählt für ihn, das hat Netanjahu nun wieder deutlich bewiesen.
So bleibt die Frage, ob der Ministerpräsident es schaffen wird, eine Lösung zum Umgang mit den Geflüchteten zu präsentieren, die realisierbar und – für seine Basis – politisch tragbar ist.
Einen Sündenbock hat der Likud-Chef jedenfalls schon ausgemacht: Der New Israel Fund, eine links-liberale Nicht-Regierungs-Organisation aus den USA, sei maßgeblich für das Scheitern aller Versuche, Abkommen mit anderen Staaten zur Aufnahme der „Eindringlinge“ auszuhandeln, verantwortlich. Diese Gruppe, die, so Netanjahu auf Facebook, von israelfeindlichen Geldgeber*innen wie George Soros finanziert werde, soll laut dem Ministerpräsidenten für ihre Einmischung in die israelische Innenpolitik zur Verantwortung gezogen werden: Eine parlamentarische Untersuchungskommission sei bereits geplant.
Netanjahus Basis scheinen diese Töne jedenfalls besser zu gefallen als humanitär anmutende UN-Deals. Allen anderen geben sie jedoch wenig Grund zur Hoffnung. Insbesondere die Geflüchteten werden unter dem politischen Machterhalts-Poker Netanjahus weiter zu leiden haben.