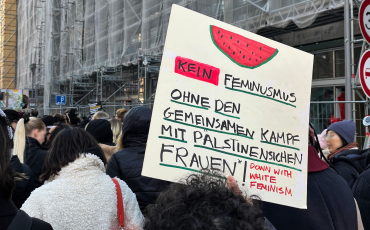Weißsein ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Einer, dessen man sich erst nach und nach bewusst wird, und dessen alltäglichen Folgen man nur allmählich begreift. Lea Frehse mit einem Versuch über Privilegien, Selbstverständlichkeiten und Möglichkeiten der Empathie.
Ich bin weiß.[1] Doch das Weißsein ist erst nach und nach in mein Leben getreten. Denn dass und wie tiefgreifend meine Sozialisation als weiße Person mich, mein Handeln, meinen Blick prägt, wird mir erst bewusst. Angeregt durch Gespräche mit nicht-weiß gelesenen und weißen Menschen, durch Beobachtungen in vertrauten Umgebungen und in der Ferne, durch Bücher oder Nachrichten. Es ist, als würde ich jeden Tag ein bisschen weißer, ein andauernder Prozess.
Wird über Rassismus geredet, dann heißt das häufig: Reden über die Betroffenen, also nicht-weiße Menschen. Sie teilen ihre Erfahrungen, damit weiße Menschen zuhören, daraus lernen. Das hat ein pädagogisches, in Teilen auch ein emanzipatorisches Moment. Es bringt aber mit sich, dass einmal mehr die Blicke weißer Menschen auf nicht-Weißen liegen. Nur: Was heißt es eigentlich, weiß zu sein? Was für Erfahrungen machen Weiße? Was für Privilegien gehen damit einher, was für Ballast?
Es gehört zum Privilegiertsein, gewöhnlich wenig von sich preisgeben zu müssen. Nicht ständig angeblickt zu werden. Was bleibt deshalb ungesehen?
Ich muss keine Geschichte haben, denn „die Geschichte“ gehört mir
Die wichtigsten Denkanstöße zum Weißsein habe ich dort gefunden, wo nicht-Weiße schreiben. Das ist erst spät passiert, die Bücher nicht-weißer Denker waren weder in der Schule Thema, noch gehörten sie danach zu dem, was „man“ so las. Ich habe Internationale Politik und Geschichte studiert, da ging es um Kriege, Entwicklung, Kolonialismus, und häufig um nicht-weiße Menschen. Das Wissen und die Einordnung aber kam ganz überwiegend von weißen Autoren. Bewusst die Bücher nicht-weißer Intellektueller zu lesen, hat sich angefühlt, wie das erste Mal in den Spiegel zu schauen.
Besonders eingeprägt hat sich mir eine Beobachtung von James Baldwin. Der US-Autor Teju Cole zitiert sie in einem seiner Essays. Baldwin schrieb in den fünfziger Jahren in „Notes of a Native Son“, wie es ihn, den Schwarzen[2] Amerikaner, in ein schweizerisches Bergdorf verschlug. Die Menschen, denen er dort begegnete, hatten die Bergwelt nie verlassen - trotzdem fühlte sich Baldwin, der Weitgereiste, behandelt wie ein Hinterwäldler, ein Weltfremder. Baldwin notierte: „These people cannot be, from the point of view of power, strangers anywhere in the world; they have made the modern world, in effect, even if they do not know it. (…) Go back a few centuries and they are in their full glory – but I am in Africa, watching the conquerors arrive.“
Gehört den Weißen die Selbstverständlichkeit der Gegenwart, weil ihnen die Geschichte gehört?
Ich bin das Kind einer weißen Familie der deutschen Mittelschicht. Über meine Herkunft, das Früher, weiß ich kaum etwas. Das Familiengedächtnis hört bei meinen Urgroßeltern auf, sie waren Bauern, Bergmann, Hafenarbeiter. Stammbäume sind doch etwas, das vor allem Familien „von Geschlecht“ pflegen. Trotzdem habe ich mich nie geschichtslos gefühlt. Die Geschichte, von denen mir Lehrer*innen und Bücher erzählten, habe ich immer als „meine“ begriffen. Meine Vorfahren haben gewiss keine Geschichte geschrieben, und doch waren sie, bin ich, im Lauf der Geschichte obenauf.
Ich habe Ängste, aber keine Angst
Wann immer ich möchte, werde ich unsichtbar. Es reicht, in der Großstadt durch die Fußgängerzone zu gehen, oder an einen Bahnhof, solange ich in Deutschland bin, gehe ich in der Menge unter. Dass das ein Privileg sein kann, habe ich erst durch nicht-weiße Freunde erfahren. Als ich mir der Blicke bewusst wurde, die mir folgten, wenn ich mit einem Schwarzen Partner unterwegs war. Als eine Bekannte erwähnte, sie achte im Supermarkt immer darauf, nicht zu lange vor einem Regal zu stehen: wissend, dass der Ladendetektiv „einer wie ihr“ sonst Fragen stellt.
Ich – weiß, weiblich, durchschnittlich – lege auf Bahnfahrten die Füße hoch, gehe über rot, mache jeden Tag Dinge, über die andere die Nase rümpfen. Sehr selten werde ich darauf angesprochen. Nie werde ich auf der Straße nach meinen Papieren gefragt. Stehe ich irgendwo rum, ist man verwundert, nicht misstrauisch. Man unterstellt mir eher gute Absichten als schlechte. Man drückt für mich Augen zu. Es hat gedauert, bis mir dämmerte, dass das eine weiße Erfahrung ist.
Dass es das Weißsein und nicht bloß das nicht-Auffallen ist, das mich auf diese Weise unbeschwert durch die Welt gehen lässt, zeigt sich daran, dass es auch dort gilt, wo ich auffalle. Ich kann mich kaum an Gelegenheiten erinnern, bei denen ich in nicht-weißen Kontexten auf Reisen als Weiße misstrauisch beäugt wurde. Wenn man mich schräg anschaute, dann weil ich als Journalistin erkennbar war, mal als Deutsche. Mir als Weiße begegnete man interessiert; verdächtigte mich eher, Geld zu haben, als „schwarzzufahren“. Ich kann reisen, allein aus Interesse, und dabei auf ein Sicherheitsnetz zählen: die Deutsche Botschaft, die Versicherung, meine Kreditkarte. Das Gefühl, schutzlos, ausgeliefert zu sein, wie es viele Migrant*innen sind, werde ich vermutlich nie haben. Die weiße Haut ist wie ein Preisschild: Ihr zu schaden kostet. Wie sehr prägt das meinen eigenen Habitus?
Ich darf fühlen ohne mitzufühlen
Am Flughafen von Kinshasa hörte ich einmal die weiße, europäische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation sagen, das Leid im Land gehe ihr nicht wirklich nahe. „Mit Schwarzen fühle ich einfach nicht so mit, wie mit anderen Weißen.“ Ich war empört. Und dann nachdenklich.
Ich kam von einer Recherche, während derer ich Jungen gesehen hatte, die in Zellen verhungerten, Frauen, die in Krankenhauszimmern eingesperrt waren, weil sie die Rechnung für die Geburt ihres Babys nicht zahlen konnten. Ich war ausgebeuteten, ausgemergelten, flehenden und wütenden Menschen begegnet. Ich hatte dabei etwas gefühlt. Aber fühlte ich mit? Ich verließ das Land genau so wie die „Helferin“. Ich wusste, es würde schwierig sein, zurück in Deutschland überhaupt einen Artikel aus dem Kongo anzubieten – eine „Afrika-Geschichte“. „Die Menschen bewegt, was ihnen nah ist“, das gilt in Redaktionen. Was ich gesehen hatte, ist der Erfahrungswelt von Menschen in Deutschland kaum nahe. Inwieweit liegt das daran, dass „die“ anders aussehen/sind? Was macht es mit „unserer“ Menschlichkeit, wenn es stimmt, dass Mitgefühl rassistisch ist?
[1] Anmerkung der Redaktion: weiß ist klein und kursiv geschrieben, denn es handelt sich nicht um eine ermächtigende Selbstbezeichnung, sondern um eine privilegierte Position innerhalb eines rassistischen Systems. Mehr dazu hier.
[2] Anmerkung der Redaktion: Schwarz wird großgeschrieben, denn es handelt sich nicht um eine adjektivische Beschreibung, sondern eine politisch gewählte Selbstbezeichnung, die kolonial geprägte und damit rassistische Bezeichnungen ablehnen. Mehr dazu hier, und im Buch von Noah Sow: Deutschland Schwarz Weiß. Der alltägliche Rassismus.