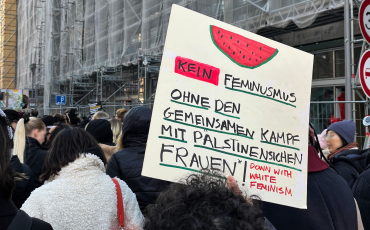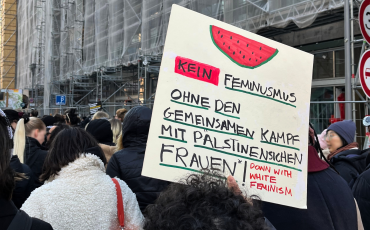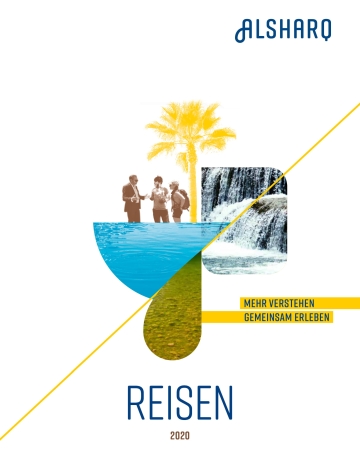Seit letzter Woche läuft die bekanntlich politisch kritische Berlinale. Trotz der aktuellen Diskurse um WANA wurde kein einziger Film aus der Region für den Goldenen Bären nominiert – leider Tradition bei Filmfestivals des Globalen Nordens.
Die Filmfestspiele in Berlin, die vom 13. bis 21. Februar 2025 zum 75. Mal stattfinden, gehören neben den Oscars, dem Festival de Cannes, der venezianischen Mostra Internazionale d’Arte Cinematograpfica und neuerdings dem saudischen Red Sea Festival zu den international renommiertesten Filmfestivals. Für den Hauptpreis, den Goldenen Bären für Langfilme, gehen dieses Jahr 19 Filme ins Rennen. Die Auswahl der Wettbewerbsfilme bei Filmfestivals ist von großer Bedeutung, denn sie bestimmt, was im Kino läuft – und ohne Berlinale Nominierung hat ein internationaler Film kaum eine Chance auf die deutschen Leinwände.
Filme aus der WANA-Region spielen auf der Berlinale eine untergeordnete Rolle, dabei ist das Profil der Berlinale eigentlich politisch kritisch. Doch obwohl Filme internationalen Ideenaustausch besonders anschaulich ermöglichen können, bleibt das Festival diesmal hinter seinen eigenen Maßstäben, ein „Ort der interkulturellen Begegnung und (…) einer Plattform kritischer filmischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen“ zu sein, zurück.
Die Antisemitismus-Debatte im Kontext der Berlinale
Im vergangenen Jahr stießen die Filmemacher Basel Andra und Yuvel Abraham des Dokumentarfilms „No Other Land“ (2024), der die israelische Siedlungspolitik dokumentiert, bei der Preisverleihung eine Debatte über Israels Behandlung der Palästinser:innen und die Besatzung palästinensischer Gebiete an. Yuval Abraham sagte damals:
„Ich bin Israeli, Basel ist Palästinenser. Und in zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, in dem wir nicht gleichgestellt sind. Diese Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit, muss ein Ende haben.“
Aus seinem Kommentar entstand eine Polemik um Antisemitismus auf der Berlinale. Das Festival reagierte darauf seinerzeit defensiv: „Die teils einseitigen und aktivistischen Äußerungen von Preisträger:innen waren Ausdruck individueller persönlicher Meinungen. Sie geben in keiner Form die Haltung des Festivals wieder.“
Und auch in diesem Jahr warfen der chinesische Regisseur Jun Li und der iranische Schauspieler Efran Shekarriz Deutschland und seinen Kulturinstitutionen die Unterstützung des Genozids an den Palästinenser:innen vor und sehen sich nun mit einer Ermittlung des Staatsschutzes konfrontiert. Somit zeigt sich erneut: Israels brutales Vorgehen gegen die Palästinenser:innen scheint Tabuthema auf dem Filmfestival zu sein.
Im aktuellen Programm greift einzig der Spielfilm „Yunan“ (2025) von Ameer Fakher Eldin Themen, die WANA-Region und das Zusammenleben in Europa betreffen, auf. Die Co-Produktion von Deutschland, Kanada, Italien, Palästina, Jordanien, Qatar und Saudi-Arabien thematisiert die Schwierigkeiten des Lebens eines arabischen Autors im Exil in Deutschland.
Der Wohnort der Filmemacher:innen macht einen Unterschied
Vor diesem Hintergrund ist es besonders schade, dass kein Film aus WANA selbst im Wettbewerb um den Goldenen Bären steht. Eine Innensicht aus Ländern, die in Deutschland momentan medial viel diskutiert werden, wäre ein konstruktiver Beitrag zur öffentlichen Debatte gewesen. Der Krieg in Gaza und dem Libanon, der Sturz Assads in Syrien oder die massiven Menschenrechtsverletzungen von Geflüchteten in Tunesien und Ägypten in Zusammenarbeit mit der EU wären Themen, die einen filmischen Perspektivenwechsel nötig hätten.
Dass Filme aus der Region oft nicht auf international renommierten Festivals kommen, ist nicht allein die Schuld der Berlinale. Die gesamte Logik der Filmindustrie und das allgemeine internationale Ungleichgewicht weisen bis heute auf strukturelle Kontinuitäten aus der Kolonialzeit auf. Die starke Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Menschen aus der WANA-Region durch restriktive Visaregime in Europa oder Nordamerika erschweren gerade den professionellen Austausch und den Aufbau eines internationalen Netzwerks für Filmemacher:innen aus der Region.
„Es geht ums Networking, Networking mit Geldgebern und mit Kollegen, wofür beispielsweise Filmfestivals eine gute Gelegenheit bieten. Dieses Netzwerk ist von großer Bedeutung allein, um die Finanzierung von Filmen zu sichern“, betont die tunesische Filmproduzentin Maleek Bouallegui. Gerade weil diese Hindernisse vielen Künstler:innen aus der WANA-Region und anderen Ländern des Globalen Südens im Weg stehen, sind die Chancen einer internationalen Filmkarriere sehr gering.
„It’s all about money“
Auch um Fördermittel anzuwerben, sind diese Kontakte, die auf Festivals geknüpft werden, wichtig. Die Finanzierungsmöglichkeiten, die in WANA-Ländern existieren, reichen oftmals nicht, um einen kompletten Spielfilm, dessen Budget bei 200.000 Euro beginnt, zu finanzieren. Dafür braucht es internationale Geldgeber:innen wie das französische Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), das deutsche German Motion Picture Fund (GMPF) oder auch den saudischen Red Sea Fund.
Insbesondere die Entstehung des Red Sea Funds 2018 ist für Filmemacher:innen aus WANA eine gute Nachricht. Der Förderfond wie das gleichnamige Festival fördern massiv Filme aus Asien und Nordafrika. Somit stehen nun mehr Mittel für Filme aus WANA zur Verfügung. Klar ist, dass diese Kulturinitiativen auch das Ziel haben, das Image der saudischen Theokratie, die meist mit fehlenden Frauenrechten in Verbindung gebracht wird, aufzupolieren und ihre internationale Deutungshoheit auszubauen. Vorgemacht haben das schon andere wie die ehemalige Kolonialmacht Frankreich.
Dass all diese Geldgeber:innen eine eigene Agenda haben und unterschiedliche Themenfelder unterstützen, ist kein Geheimnis und betrifft nicht nur Filme aus der WANA-Region. Ein Problem, das sich jedoch besonders Filmemacher:innen aus dem Globalen Süden stellt, ist die erzwungene Exotisierung ihrer Filme. Geldgeber:innen erwarten oft eine klischeehafte Zurschaustellung angeblicher nationaler Eigenheiten des Landes. Diese Erfahrung machte auch der tunesische Regisseur Walid Mattar bei der Suche nach Finanzierung für seine Dramödie „Le pont“ (2024). „Es war mehr als schwer, die Finanzierung zu garantieren. Wir sahen uns wiederholt mit der „Kritik“, der Film sei nicht tunesisch genug, konfrontiert“, erzählt er über die Reaktion der Jury einer namhaften Filmförderung.
Der ungleiche Blick auf Filme des Globalen Südens
„Ein weiteres Problem besteht darin, dass Filme, die nicht aus dem Globalen Norden kommen, nicht richtig ernstgenommen werden“, sagt Haroun Ben Youssef, ein ehemaliger Mitarbeiter der tunesischen Cinemathèque. Auf internationalen Festivals im Globalen Norden gibt es oft separate Kategorien, wie Un certain regard (dt.: Ein gewisser Blick) des Festivals von Cannes, mit denen kunstvolle Filme von unbekannteren Filmemacher:innen ausgezeichnet werden. Diese Sonderbehandlung suggeriert, dass Filme aus dem Globalen Süden nicht mit den europäischen oder nordamerikanischen mithalten können. Plausibel ist das nicht, denn allen voran Ägypten, Tunesien und Algerien blicken auf eine lange und stichhaltige Kinotradition zurück.
Die stiefmütterliche Behandlung von Filmen aus der WANA-Region fiel bereits dem tunesischen Cineasten Taher Cheria während eines Besuches auf der Berlinale in den 60er-Jahren auf, als er bei der Vorführung eines ägyptischen Films der einzige Zuschauer war. Daraus schloss auch er, dass Filme aus WANA und dem Globalen Süden in Europa und den USA generell nicht genügend gewürdigt werden. Deshalb gründete er 1974 das tunesische Filmfestival Journées Cinémathographiques de Carthage (JCC), das einen dekolonialen Gegenentwurf zur damals hauptsächlich von den USA und westeuropäischen Ländern wie Frankreich dominierten Kinowelt bietet. Das JCC schickt ausschließlich Filme aus Westasien und Afrika in den Wettbewerb, um Filmemacher:innen aus diesen Ländern eine Plattform zu bieten.
Filmpreise und globale Differenzen: Ein strukturelles Problem
Diese Geringschätzung im Globalen Norden schlägt sich auch in den Auszeichnungen nieder: Den Hauptpreis der US-amerikanischen Academy Awards, den Oscar für den besten Film, erhielt bis heute kein Film aus dem Globalen Süden. Das mag auch daran liegen, dass die Oscars eher auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet sind, den Filme aus Ländern des Globalen Südens allein durch die strukturellen Nachteile nicht erreichen können. Die Berlinale, das Festival de Cannes und die Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica würdigen dagegen vorrangig die künstlerische Leistung eines Films. Aber auch auf den europäischen Festivals halten sich die Auszeichnungen für den Globalen Süden in Grenzen. Von ihnen gewannen in den letzten 24 Jahren in Venedig nur vier einen Goldenen Löwen und nur zwei die Goldene Palme in Cannes.
Auch in Deutschland stehen auf der Liste der Gewinner des Goldenen Bären vorrangig die USA und westeuropäische Länder. Aber seit den 2000er-Jahren wurden auch acht Filme des Globalen Südens ausgezeichnet. Darunter finden sich einige aus der WANA-Region, wie der türkische Film „Bal“ (2010) über eine Vater-Sohn-Geschichte in einer entlegenen Region der Türkei oder der iranische Film „Taxi“ (2015) mit Stimmen aus der iranischen Gesellschaft.
Die Berlinale setzte damit schon erste Akzente für das dekoloniale Neudenken von globalen Strukturen. Es bleibt zu hoffen, dass auch seine politisch kritische Note in Zukunft wieder mehr in den Vordergrund rückt und damit aktuelle gesellschaftliche Debatten im Zusammenhang mit der WANA-Region aufgefangen werden – also eine Rückbesinnung auf den Gründungsanspruch der Berlinale als „Schaufenster der freien Welt“.