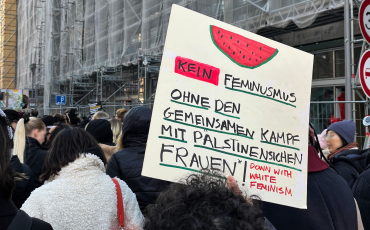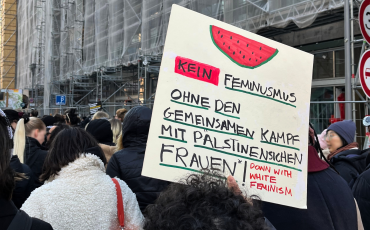Was bedeutet der 7.Oktober für Aktivist:innen in Israel und Palästina? dis:orient im Gespräch mit einem palästinensischen und einem israelischen Mitglied von Combatants for Peace über Bildung, Solidarität und ihre Arbeit während des Krieges in Gaza.
Combatants for Peace (CfP) ist eine binationale Basisorganisation. Sie wurde 2005 von ehemaligen israelischen und palästinensischen Kämpfern gegründet, die sich einst aktiv an der Spirale der Gewalt beteiligt hatten. Ihre Mitglieder engagieren sich gewaltfrei gegen die Besatzung, und setzen sich für Freiheit und Gleichheit für alle Menschen in Palästina und Israel ein.
Eszter Koranyi lebt in Jerusalem. Seit über sechs Jahren engagiert sie sich bei CfP und koordinierte lange Zeit die israelische Freedom School. Vor kurzem wurde sie zur israelischen Co-Direktorin von CfP ernannt.
Nimala Kharoufeh lebt in Bethlehem, drei Generationen nach der palästinensischen Nakba 1948. Sie ist seit ihrer Kindheit politisch aktiv und engagiert sich für verschiedene Formen des gewaltfreien Widerstands. Bei CfP arbeitet sie unter anderem als Organisatorin der palästinensischen Freedom School.
Hinweis: Das Interview wurde vor dem Vormarsch und Angriff des israelischen Militärs auf Rafah geführt und geht daher nicht auf Ereignisse seitdem ein.
Eszter, Nimala, wie habt ihr persönlich den 7. Oktober erlebt?
Nimala: Der Tag selbst war ein Schock für mich. Ich wurde von den Sirenen geweckt, die Alarm schlugen, weil aus Gaza Raketen auf Jerusalem abgefeuert worden waren. Als Palästinenserin fühlten sich die Bilder, die den Einsturz der Apartheidmauer zeigten, für mich zunächst etwas wie ein Erfolg an. Aber ich habe eben nur die eine Seite der Nachrichten gesehen. Als ich am Nachmittag die anderen Geschichten hörte, war ich noch schockierter. Ich meldete mich bei meinen jüdisch-israelischen Freund:innen, die nahe der Grenze zum Gazastreifen leben, und bei meinen palästinensischen Freund:innen in Gaza, um zu erfahren, wie es ihnen geht und ob sie okay sind. Die Luftangriffe auf Gaza begannen noch in der Nacht des gleichen Tages. Ich dachte, es würde nur ein paar Tage andauern, aber jetzt sind es schon Monate kollektiver Bestrafung. Die Menschen im Gazastreifen hungern, Hilfslieferungen werden vom israelischen Militär und von Demonstrant:innen blockiert, mehr als die Hälfte der Häuser wurden zerstört, und jede:r hat jemanden verloren – es gibt so viel Leid.
Eszter: Wie Nimala bin ich von den Sirenen aufgewacht. Ich war mit meiner Familie zu Besuch bei Freund:innen in Tel Aviv für die Sukkot-Feiertage, dem einwöchigen jüdischen Laubhüttenfest. Ich stand unter Schock – die ganze israelische Gesellschaft stand unter Schock. Für Menschen, die sich der humanitären Situation in Gaza seit Jahren bewusst sind, und warnende Stimmen in Israel, war es wahrscheinlich nicht überraschend, dass etwas passiert. Aber die schiere Brutalität der Angriffe der Hamas war nichts als erschütternd. Um irgendwie zu funktionieren, beschloss ich in den ersten Tagen keine Bilder oder Videos anzuschauen. Ich konnte nicht schlafen. Ich erinnere mich, dass ich mir Sorgen machte: Wie kann ich meinen Kindern erklären, was passiert ist?
Wie seid ihr bei CfP damit umgegangen in diesen ersten Wochen?
Eszter: Wir starteten sehr bald mit nationalen und binationalen Treffen. Es war uns wichtig, unsere Gemeinschaft aufrechtzuerhalten – aber zugleich war das äußerst schwierig und emotional. Bei einem unserer ersten Treffen nach dem 7. Oktober leugnete jemand Vergewaltigungen, die Tötung unschuldiger Menschen und die Gewalt der Hamas.
Ich meldete mich bei einer Freundin, die Familie in Gaza hat, und fragte mich, ob sie überhaupt noch mit mir, einer Israelin, spricht, angesichts dessen, was ihre Familie gerade durchmacht. Es waren so viele gemischte Gefühle, so viele Ebenen – für mich persönlich und innerhalb der Organisation.
Nimala: Wir hatten in unserer Gemeinschaft eine Menge Zweifel: Sollen wir reden? Wollen wir überhaupt reden? Aber wir begannen unsere Treffen wieder und es gelang uns, die Perspektive der anderen zu sehen. Wir palästinensischen Mitglieder wissen um die schrecklichen Dinge, die im Gazagürtel [den Gebieten im Süden Israels in der Nähe des Gazastreifens, Anm. d. Red.] geschehen sind, weil wir die Möglichkeit hatten, mit Israelis zu sprechen.
Wenn wir leiden, sehen wir andere Realitäten oft nicht. Die Luftangriffe auf Gaza begannen in der Nacht des 7. Oktobers. Von diesem Moment an machten viele Palästinenser:innen dicht. Es blieb kaum Zeit, zu verdauen und Empathie für das zu entwickeln, was am Morgen vorher in Israel passiert war. In der ersten Nacht starben über 700 Palästinenser:innen, jetzt sind es über 33.000 [Stand: April 2024][1] und die Menschen hungern. Die israelischen Medien zeigen immer nur eine Seite und Netanjahu und andere Politiker der Regierungskoalition bezeichnen Palästinenser:innen als „Tiere“.
Welche Rolle spielen die Medien dabei?
Eszter: Als CfP sind wir enorm betroffen von der Diskrepanz in der Berichterstattung in den Medien. Palästinenser:innen haben unterschiedliche Bilder und Informationen darüber, was am 7. Oktober passiert ist. Mit diesen Unterschieden müssen wir uns bei CfP auseinandersetzen. Wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass wir ein gemeinsames Verständnis des Ausmaßes dieses Grauens teilen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich einen Unterschied machen...
Nimala: Ja, es ist eine ständige Herausforderung. Wenn man sich die israelischen Medien anschaut, gibt es nichts zu Gaza. Israelische Influencer:innen auf Instagram sagen, dass alle Bewohner:innen des Gazastreifens Terrorist:innen sind, was natürlich nicht stimmt. Mehr als 14.000 Kinder wurden getötet! [Stand: April 2024] Die unterschiedlichen Darstellungen in den Medien führen zu einer großen Kluft zwischen der palästinensischen und der israelischen Gesellschaft; alle zeigen die Seite, die sie zeigen möchten. Es ist ein Teufelskreis aus Hass und Hetze auf beiden Seiten.
Eszter: Doch, die israelischen Medien erwähnen Gaza. Sie müssen schließlich erklären, warum tausende Soldaten immer noch im Einsatz sind und dort kämpfen. Väter aus dem Kindergarten meiner Kinder kämpften dort. Es ist eine verrückte Realität, wenn man darüber nachdenkt. Natürlich kann man das Leid der Menschen im Gazastreifen nicht damit vergleichen. Dennoch ist es für Kinder in Israel schrecklich, ihre Väter monatelang nicht zu sehen. Und es ist im Alltag der Menschen sehr präsent. Ich habe Freund:innen, die sagen: „Khallas, der Krieg muss aufhören“, und ich kenne Leute, die sagen: „Diese Leute sind Terroristen, also ist es okay, dass mein Mann noch in Gaza kämpft. Vielleicht wird er sterben, aber es ist der einzige Weg, um Israel retten“. Es gibt also schon Nachrichten über Gaza, aber – mit wenigen Ausnahmen – sieht man nur Zahlen und nicht das menschliche Leid.
Könnt ihr uns mehr über eure Arbeit mit jungen Israelis und Palästinenser:innen bei CfP erzählen?
Nimala: Unser palästinensisches wie unser israelisches Programm zielen darauf ab, einen sicheren Raum für Jugendliche zu schaffen, in dem sie ihr politisches Bewusstsein schärfen und sich an gewaltfreien Aktionen beteiligen können. In der palästinensischen Freedom School sprechen wir über Themen, die in den regulären Lehrplänen nicht behandelt werden: Über ihre persönlichen Geschichten, die verschiedenen Narrative, die Machtdynamik und gewaltfreien Widerstand. Während unseres sechsmonatigen Programms helfen die Teilnehmenden Landwirt:innen in den C-Gebieten oder treffen Menschen, die von Hauszerstörungen durch das israelische Militär betroffen sind. Wir sprechen auch über die Nakba und den Holocaust, und wie diese Erfahrungen unsere jeweiligen Gesellschaften bis heute prägen. Am Ende des Programms haben sie die Möglichkeit, Teilnehmende der israelischen Freedom School zu treffen.
Eszter: Die Idee der israelischen Freedom School ist ähnlich. Teil unseres Programms ist, das israelische Narrativ zu dekonstruieren, palästinensische Narrative und die Nakba kennenzulernen und zu ergründen, was das für unsere Identität bedeutet. Im Grunde bedeutet es also: vieles neu zu lernen. Eine Gemeinschaft zu finden und gleichgesinnte Menschen zu treffen, ist wichtig, weil viele der Teilnehmenden das zuhause oder in ihrem Freund:innenkreis sonst nicht haben.
Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf eure Programme aus?
Nimala: Die Teilnehmenden des palästinensischen Programms können sich erst seit kurzem wieder vor Ort treffen. Angesichts der anhaltenden Siedlergewalt und der israelischen Militärpräsenz auf den Straßen im Westjordanland ist es für viele von ihnen nach wie vor nicht sicher, unser Büro in Bethlehem zu besuchen. Für junge Palästinenser:innen sind Einschränkungen ihrer Mobilität ein konstantes Thema. Einige der Teilnehmenden sind in ihren Zwanzigern und waren noch nie in Jerusalem – dabei ist das nur eine Stunde entfernt. Das ist die Ungerechtigkeit der Besatzung.
Eszter: Eine Kohorte unseres israelischen Programms mussten wir zu Beginn des Jahres absagen, erst vor kurzem konnten wir wieder starten. Es war jedoch sehr wichtig, einen geschützten Raum für unsere Alumni zu erhalten. Nach dem 7. Oktober standen viele von ihnen unter Schock, die Vorlesungen an den Universitäten fielen aus, und sie fürchteten um ihren Arbeitsplatz. Sie waren zu Hause, abgeschottet und weitgehend politisch isoliert. Unsere Alumni versuchen zu helfen, wo sie können: zum Beispiel durch protective presence [Schutz durch Präsenz vor Ort, Anm. d. R.] im Westjordanland, um der Gewalt der Siedler entgegenzuwirken und durch Vorträge für junge Israelis über den Gazastreifen und zu jenen Perspektiven, die in den Medien fehlen. Hunderte junge Menschen nahmen an diesen Vorträgen teil.
Insbesondere im europäischen Diskurs zu Palästina und Israel besteht die Tendenz, den „Dialog“ als Instrument der Konfliktbeilegung zu romantisieren. Was ist eure Meinung dazu und wie ist eine Begegnung mit der anderen Seite angesichts der Realität vor Ort überhaupt möglich?
Nimala: Militärische Optionen sind keine Lösung. Wir brauchen einen anderen Weg. Dazu gehört auch, die andere Sichtweise zu sehen und zu verstehen. Seit dem Osloer Abkommen habe ich an vielen Koexistenz-Programmen mitgewirkt. Die meisten von ihnen vermieden es, sich eingehend mit den Ursachen des Konflikts auseinanderzusetzen. Wir sprachen nicht über die Nakba oder den Holocaust, auch nicht über die Angst, den Nationalismus oder die Beziehung zwischen Politik und Religion. Wir sprachen über Frieden – „Yallah, lass uns Hummus und Falafel essen“ – aber es gibt Besetzte und Besatzer. Viele hatten die Absicht, Frieden zu schaffen, aber sie haben die politische Realität nicht berücksichtigt.
Eszter: Unsere Erfahrungen mit klassischen Dialoggruppen haben uns gezeigt, dass ein Treffen mit der anderen Seite ohne Vorbereitung sehr oberflächlich sein kann: Der erste Reflex vieler Menschen ist eine Abwehr- und Verteidigungshaltung. Wir starten daher mit nationalen Prozessen und gehen erstmal mit Menschen in den Austausch, die mit denselben Narrativen aufgewachsen sind. Wir schaffen Raum für Komplexität und Reflektion – die andere Seite treffen sie erst später. Auf israelischer Seite müssen wir bereit dazu sein, einen Teil des Territoriums zurückzugeben und einige unserer Erwartungen fallenzulassen, um Land für alle zu haben.
Nimala: Bei CfP bezeichnen wir Palästinenser:innen die israelischen Mitglieder als unsere Partner:innen, auch wenn sie nicht in gleichem Maße unter der Besatzung leiden wie wir. Wir alle teilen die Überzeugung, dass die Besatzung enden muss, und setzen uns dafür ein. Dies wurde im Zuge des 7. Oktobers noch deutlicher. Wir arbeiten nicht mit Leuten in (Armee-)Uniform zusammen oder mit Leuten, die nach dem 7. Oktober sofort wieder der Armee beigetreten sind. Diese Leute sind nicht mehr willkommen! Denn obwohl sie an unserem Programm teilgenommen und Palästinenser:innen persönlich getroffen haben, sind sie zurück in den Krieg gezogen.
Unsere Teilnehmenden begreifen, dass keine Seite dieses Land verlassen wird und dass wir einen Weg finden müssen, miteinander zu leben. Wir lehren in den Freedom Schools, dass es wichtig ist, die eigene Verantwortung anzuerkennen und aktiv Verantwortung zu übernehmen. Trotz des Vorwurfs, dass unsere Organisation die Besatzung normalisiert, hatten wir im April über 50 Bewerbungen für unseren neuen palästinensischen Jahrgang – und aktuell über 25 Personen, die teilnehmen. Junge Palästinenser:innen lieben das Leben und wollen in diesem Land eine Zukunft finden.
Was bedeutet Solidarität für euch?
Nimala: Für mich bedeutet Solidarität, das Richtige in diesem Land zu unterstützen: Gerechtigkeit, die Wahrung des Existenzrechts der Menschen, Gewaltfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser:innen innerhalb der Grenzen von 1967. Das bedeutet auch: die Militäroperation in Gaza nicht zu unterstützen. Was wir hier tun, ist nicht einfach. Wir haben den Anspruch offen zu sein, mit der anderen Seite zu sprechen und eine gemeinsame Vision für die Zukunft zu finden. Das ist es, was ich mir von solidarischen Menschen wünsche: Menschen zu unterstützen, die wirklich eine gute Absicht, eine gute Vision für dieses Land haben. Die an den Frieden glauben und ihn leben – nicht nur durch Worte, sondern durch konkretes Handeln, yani, als Prinzip in ihrem Leben.
Was bedeutet das für die internationale Politik?
Nimala: Die Besatzung zu beenden, ist die einzige dauerhafte Lösung. Dafür sollten sich Europäer:innen einsetzen. Es reicht nicht aus, einen Bericht zu schreiben. Wirkungsvolle Maßnahmen wären Sanktionen zu verhängen oder Israel vor Gericht zu bringen, wie es Südafrika Anfang des Jahres getan hat. Israel hält sich nicht an die Grenzen von 1967[2]. . Seitdem sind über 50 Jahre vergangen, und wir sehen die fortlaufende Erweiterung illegaler Siedlungen und immer isolierterer Gemeinden im Westjordanland. Die internationale Gemeinschaft hat das mitzuverantworten – sie hat versagt.
Eszter: Ich stimme zu, wir brauchen die Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Israels Kriegsverbrechen zu legitimieren, ist nicht der richtige Weg. Die USA, Deutschland und andere sollten aufhören, die israelische Armee zu finanzieren – oder zumindest finanzielle Mittel kürzen – sodass wir in den Schutz der international vereinbarten Grenzen investieren und nicht in die Unterdrückung der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Ich habe keine großen Hoffnungen hinsichtlich der EU, aber eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Palästina, die Stärkung ziviler Kräfte und Investitionen in Friedensbildung, würden auch helfen.
Trotz alledem setzt ihr eure Arbeit fort...
Nimala: Ich habe keine andere Wahl. Ich sehe immer noch eine Möglichkeit, in Frieden in diesem Land zu leben, und das gibt mir Hoffnung und Kraft, meine Arbeit fortzusetzen. Meine Vorfahren kommen aus diesem Land, meine Familie lebt hier. Dies ist meine Heimat, ich liebe sie und möchte, dass es ihr gut geht.
Eszter: Das sehe ich genauso. Die letzten Monate haben mich noch entschlossener gemacht: dass es aufhören muss und dass wir es auf beiden Seiten verdienen, in Frieden zu leben. Ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort werden kann. Es kommt auf jede einzelne Person an, nicht nur auf die Politik. Diese Haltung und Denkweise habe ich von meinen beiden Großmüttern. Nachdem sie den Holocaust überlebt hatten, haben sie es geschafft, sich ein neues Leben aufzubauen, Familie, eine Karriere. Wenn sie dazu in der Lage waren, wer bin ich, aufzugeben?
[1] Die UN haben bislang keine eigenen Zahlen vorliegen. Diese Angabe bezieht sich auf Angaben des Gesundheitsministerium und des Medienbüro in Gaza.
[2] „Grenzen von 1967" ist ein gängiger Begriff, der die Demarkationslinie vor dem Krieg 1967 beschreibt. Diese Grenzen sind international weitgehend anerkannt und werden in internationalen Dokumenten erwähnt.