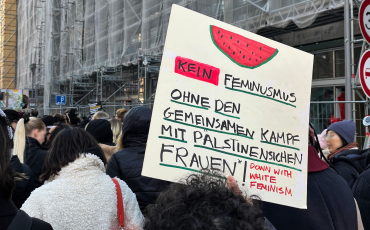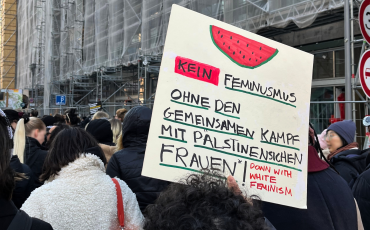Für meine Arbeit als Organisatorin von Bildungsreisen nach Israel und Palästina besuche ich mit Gruppen regelmäßig palästinensische Flüchtlingslager im Westjordanland. Mein Aufenthalt hier ist weder legal nach israelischem Recht noch von den Bewohner*innen des Lagers erwünscht, denn ich bin Jüdin und israelische Staatsbürgerin. Diese Wanderungen zwischen zwei Welten ermöglichen mir einen gedanklichen Perspektivenwechsel.
Der Schlüssel über dem Eingangstor zum Flüchtlingslager Aida bei Bethlehem ist der größte Schlüssel der Welt, so die Legende. Jedes Mal, wenn ich durch das Tor trete, empfinde ich eine Mischung aus Ehrfurcht und Irritation. Implizit negiert der Schlüssel als Symbol meine Existenz im Staat Israel, so die Interpretation auf jüdisch-israelischer Seite. Gleichzeitig weiß ich: Es ist nicht mein Recht, irgendjemandem, der in diesem Lager lebt –auch nur in Gedanken – vorzuschreiben, was er oder sie fühlen oder wovon sie träumen sollen.

Der Schlüssel wurde aus Stahl gefertigt, ist eine Tonne schwer und neun Meter lang. 2008 stellten ihn die Bewohner*innen des Lagers in einem Gemeinschaftsakt her, als Symbol und Andenken an die verlorenen Häuser, aus denen ihre Väter und Großväter 1948 als Resultat des Krieges mit Israel vertrieben wurden. Damals verloren etwa 720 000 Menschen ihre Häuser. Sie wurden in Aktionen ethnischer Säuberungen vertrieben oder flohen aus eigener Initiative in den Gazastreifen, ins Westjordanland, den Libanon, nach Jordanien, Syrien, Ägypten und den Irak. Die Schlüssel zu ihren Häusern behielten die Flüchtlinge in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr nach Kriegsende.
70 Jahre später hat sich die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge weltweit auf etwa 5,4 Millionen vervielfacht. 1.3 Millionen von ihnen leben im Gazastreifen und etwa 800 000 in den von Israel besetzten Gebieten des Westjordanlandes sowie im annektierten Ostjerusalem. Viele führen ein Leben in Armut, geprägt von Arbeitslosigkeit, Wassermangel und gewalttätigen Zusammenstößen mit der israelischen Armee. In Aida leben über 6400 Menschen auf engstem Raum. Eine Studie, die Forscher am Human Rights Center der kalifornischen Universität Berkeley 2017 durchführten, zeigt, dass die Belastung durch Tränengas in diesem Lager die höchste weltweit ist. Kinder und Erwachsene sind dem Reizstoff im Durchschnitt mehrmals die Woche ausgesetzt. Eine Realität, die verheerende Konsequenzen für die körperliche und seelische Verfassung der Lagerbewohner*innen hat.
Palästinenser*innen fordern "Recht auf Rückkehr"
Jamal, unser Gastgeber in Aida, wurde im Lager geboren und wuchs hier auf. Heute dokumentiert er als Fotojournalist das tägliche Leben und die gewalttätigen Zusammenstöße mit der israelischen Armee. Wie politischer Widerstand kreativ sein kann, bringt er auch den Kindern im Kulturzentrum des Lagers durch Fotografiekurse bei. Jamal ist erst Ende zwanzig, wirkt aber älter. Durch sein Gesicht zieht sich eine Narbe, die zwar abgeheilt, doch kaum zu übersehen ist. 2012 schossen ihm israelische Soldaten mit einem Gummigeschoss ins Gesicht, während er sie filmte. Es bedurfte mehrerer Operationen, um das Geschoss zu entfernen und seinen zerschmetterten Wangenknochen zu behandeln. Doch davon erzählt er selten, überhaupt weiß ich wenig Persönliches über ihn.
Unser Verhältnis ist kühl, aber freundlich. Manchmal, wenn wir gemeinsam für die Besucher*innen das palästinensische Nationalgericht Maklube auf Plastikteller schaufeln, lächeln wir uns an. Ich weiß, dass er um meine Identität weiß, obwohl wir nie darüber gesprochen haben. Ich bringe ihm Touristengruppen, die für das kulturelle Zentrum im Lager eine wichtige Einnahmequelle sind. Einmal schaute ich ihm direkt in die Augen und fragte ihn, ob er mit Israelis in Berührung gekommen sei, die nicht SoldatInnen sind. Nein, sagte er, er könne kein Vertrauen fassen, dazu hätte man ihm zu viel angetan.
Ein Spaziergang durch Aida ist eine absurde Erfahrung, ein bisschen wie durch ein Bilderbuch des Elends. Die engen und bunt bemalten Gassen des Lagers erzählen ihre eigene Geschichte. Die Motive: Freiheit, Widerstand, Hoffnung. Viele der Graffitis sind zweisprachig, auf Englisch und Arabisch: sie sollen eine eindringliche Botschaft an die Touristen aus dem Westen senden, die das Lager besuchen. “Uns wurde Unrecht getan und wir werden nicht aufgeben, bis wir Gerechtigkeit erfahren!” Immer wieder taucht unter den Zeichnungen die israelische Landkarte auf, der weiß-blaue Davidstern ersetzt durch die Farben der palästinensischen Flagge.
Der Traum: Eine Rückkehr nach Hause, in dieselben Dörfer, wo ihre Väter und Großväter Olivenbäume pflanzten und ihre Felder bestellten. Der Traum lebt und wird von Generation zu Generation weitergegeben, in naiv wirkenden Kinderzeichnungen und sehnsüchtigen Erzählungen. Nur die wenigsten Palästinenser*innen können heutzutage “ihre” Dörfer von damals auch nur besuchen, die Abwesenheit von Freiheit durch den Konflikt und die von Israel erbaute Sperranlage machen das Reisen in den meisten Fällen unmöglich. So bleibt der Traum ein Traum und die Forderung nach dem “Recht auf Rückkehr” ein trauriges Mantra. Auf politischer Ebene stellt diese Forderung einen der zentralen Konfliktpunkte dar.
Israelis fürchten eine Wiederholung der Vergangenheit
Jedes Mal, wenn ich von meinen Reisen nach Hause zurückkehre, in das hedonistische Tel Aviv ohne Tränengas und Wassermangel, überfallen mich irrationale Schuldgefühle für mein Leben hier. Warum durfte ich, die lediglich eine historische Verbindung zum Land habe und in Deutschland aufgewachsen bin, problemlos einwandern, während Palästinenser*innen, deren Familien Jahrhunderte lang hier lebten, selbst ein Besuch verwehrt wird? Was ist die interne Logik, die solch einer Politik zugrunde liegt?
Wenn ich meinen israelischen Freund*innen – selbst den linksliberalen unter ihnen – von meinen Besuchen im Flüchtlingslager erzähle, mutet der palästinensische Traum wie ein schlechter Witz an. “Zurückkehren wohin? Nach Israel? Wie soll das gehen?”, fragen sie verwirrt. Nur die wenigsten der Dörfer von 1948 existieren noch. Für viele jüdische Israelis käme eine israelische Einwilligung auf das Recht zur Rückkehr einem Ende Israels als jüdischer Staat gleich. Diese würde bedeuten, dass zumindest rein theoretisch Millionen Palästinenser*innen sich innerhalb der Grenzen des jüdischen Staates ansiedeln dürften und jüdische Staatsbürger plötzlich eine Minderheit inmitten einer feindlich gesinnten, arabischen Mehrheit wären. Allein der Gedanke daran bereitet vielen Unbehagen und löst einen kollektiven Abwehrmechanismus gegen diese Idee aus. Die Angst davor, dass Geschichte sich wiederholen könnte, sitzt zu tief.
Ich weiß, mit kluger Politik auf beiden Seiten könnte man diese Fragen pragmatisch lösen. Modelle dazu existieren genug, wären da nur Bereitschaft und der politische Wille. Gäbe es für Palästinenser*innen eine entsprechende finanzielle Kompensation als Wiedergutmachung für die Vertreibung von 1948 und einen eigenen Staat, der dem palästinensischen Volk Sicherheit, Würde und Freiheit, Wirtschaftswachstum und fließendes Wasser gewähren würde, wäre eine Rückkehr tatsächlich immer noch entscheidend für Frieden? Wie viele würden in diesem Falle immer noch zurückkehren wollen? Auch wenn es einige Hunderttausend wären –diese demographische Veränderung könnte Israel verkraften, würde sie politischen Frieden bedeuten.
Opfernarrative lähmen
Mehr als um die eigentliche Implementierung des Rechts auf Rückkehr geht es hier jedoch um die Kluft zwischen zwei Narrativen, die unüberbrückbar scheint. Zwei Völker, die sich als absolute Opfer sehen und in der Reproduktion dieses Narratives gelähmt sind. Dies bedeutet nicht, dass die gegenwärtige Kräfteverteilung im Konflikt nicht asymmetrisch ist und die israelische Seite unverhältnismäßig mächtiger. Vielmehr hat sich die Wahrnehmung des jeweiligen kollektiven Selbst losgelöst von den eigentlichen Machtverhältnissen. Die Ansammlung von Geschichten, Erinnerungen, Symbolen und Denkmustern haben dieses kollektive Selbst auf beiden Seiten jahrzehntelang genährt. In diesem Nexus einen Platz für das Narrativ eines anderen Volkes zu schaffen, würde Mut und radikale Selbstkritik erfordern.
Das palästinensische Recht auf Rückkehr anzuerkennen wäre ein Akt der Einsicht auf israelischer Seite, diesem Volk ein Unrecht zugefügt zu haben, das nach Wiedergutmachung schreit. Dieser Schritt würde für Israel bedeuten, sich mit der dunklen Seite seiner jungen Geschichte auseinanderzusetzen und schmerzhafte Fragen zu stellen, Geschichtsbücher umzuschreiben. Vor allen Dingen würde es bedeuten, endlich zu lernen, kollektiv das Wort “Nakba” (arabisch für “Katastrophe”) auszusprechen und die Geschehnisse von 1948 aufzuarbeiten. Palästinenser*innen hingegen müssten akzeptieren, dass sie das Stückchen Erde zwischen dem Mittelmeer und Jordan nicht für sich alleine haben werden. Dass hier Millionen von Jüdinnen und Juden leben, die eine historische und emotionale Verbundenheit zu diesem Ort haben, die sich nicht leugnen lässt, weder mit Worten, noch mit Symbolen wie einer Palästina-only Landkarte. Dass die Zeit nicht zurückgedreht werden kann und die jüdischen Bewohner*innen sich nicht in Luft auflösen werden.
Ich weiß, dass Jamal aus Aida mir in diesen Überlegungen wahrscheinlich nicht zustimmen würde. Er versteht das Recht auf Rückkehr als unantastbar, im wortwörtlichen Sinne. Vielleicht könnte er überzeugt werden, wenn er eine Veränderung in seinem Alltag erfahren würde. Erwarten kann ich es von ihm nicht. Toleranz ist einfacher, wenn man nicht jede Woche Tränengas einatmen muss.
Marina Klimchuk wurde in der Ukraine geboren und kam als Kind jüdischer Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Nach ihrem Soziologiestudium in München zog sie nach Tel Aviv, wo sie multi-narrative Bildungsreisen nach Israel und Palästina organisiert.