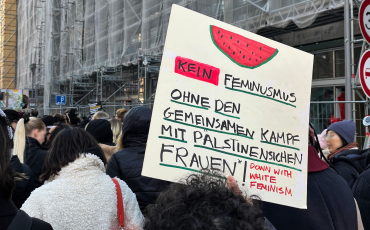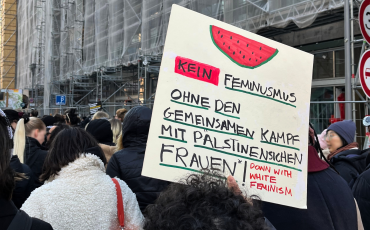Migration bedingt Verlusterfahrungen – über Generationen hinweg. Die daraus resultierenden Schmerzen werden jedoch in den einschlägigen Debatten zu selten in den Blick genommen, findet Nushin Atmaca.
In deutschen Debatten wird Migration zwar oft emotional verhandelt, aber vor allem aus Sicht der „aufnehmenden“ Dominanzgesellschaft, deren Befindlichkeiten die Diskussionen antreiben. Befindlichkeiten ist dafür tatsächlich der treffende Ausdruck. Denn im Angesicht der strukturellen Ausschlüsse, der kolonialen Fortsetzungen in politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, der tolerierten Kriege, die Leben kosten und Existenzen vernichten, erscheinen die Sorgen, Verlust- und „Überfremdungs“- Ängste der Dominanzgesellschaft tatsächlich unangemessen und überzogen.
In diesen Diskussionen, ob sie nun öffentlich ausgetragen werden oder im privaten Raum stattfinden, werden meistens Ansprüche an Migrant:innen und Migrantisierte formuliert. Wer darf hier sein? Was muss diese Person leisten, um ihr Hier-Sein zu legitimieren? Und was muss sie vergessen, verdrängen und ablegen, um ankommen zu dürfen? Bei all diesen Fragen steht die vermeintliche Bringschuld derjenigen, die als nicht „deutsch genug“ empfunden werden, im Mittelpunkt. Selten geht es hingegen um den Verlust, den Migration mit sich bringen kann. Allzu oft unsichtbar bleibt der Schmerz, den Migrant:innen und Migrantisierte empfinden.
Löcher, die sich nicht stopfen lassen
Oft sind die Lücken und Löcher, die eine familiäre Migrationsgeschichte in ein Leben reißen kann, so groß, dass sie sich nicht stopfen lassen. Dennoch bleiben sie ungesehen und verdeckt. In der Öffentlichkeit ist dafür kein Platz – nicht zuletzt, weil der Dominanzgesellschaft der Wille fehlt, diese Dinge zu thematisieren. Und was im Öffentlichen unsagbar bleibt, hat oft auch im Privaten keinen Raum.
Dennoch gibt es ihn: den Schmerz. Angehörige der ersten Generation – diejenigen, die selbst migriert sind – empfinden ihn. Der Schmerz äußert sich zum Beispiel in der Sehnsucht nach Vertrautem, seien es Landschaften und Straßenzüge, Gerüche und Geschmäcker, Sprache und soziale Praktiken. Der Verlust der (ersten) Heimat, gerade wenn sie durch kriegerische Konflikte unzugänglich geworden ist, tut weh. Die Vergänglichkeit der eigenen, möglicherweise glücklichen Kindheit und Jugend, die oft mit dieser Heimat verbunden ist, kann diesen Schmerz verstärken. Anstelle einer als selbstverständlich empfundenen Zugehörigkeit entstehen Leerstellen.
Schmerz über Generationen hinweg
Aber der Schmerz kann auch Angehörige der zweiten Generation – die Migrantisierten, die Hier-Geborenen – plagen. Oft übertragen sich die Schmerzen der Eltern, ihre Verlust- und Existenzängste auf die Kinder. Gleichzeitig hat diese Generation ihre eigenen Schmerzen. Doch was löst diese aus, was schmerzt eigentlich?
Als Angehörige der zweiten Generation bin ich in den 1980ern in der BRD geboren, aber im Verständnis der Dominanzgesellschaft noch lange nicht in Deutschland verortet. Ich brauche ein Gütesiegel. Möglicherweise besitze ich dieses sogar durch die Staatsbürgerschaft und dadurch, dass ich die deutsche Sprache beherrsche. Gleichzeitig empfinde ich es als anmaßend, dass andere Bürger:innen dieses Landes sich dazu bemüßigt fühlen, dieses Gütesiegel überhaupt erst auszustellen. Das verletzt.
Ebenso schmerzt es mich, wenn in öffentlichen Debatten oder privaten Gesprächen gefordert wird, dass Muslim:innen sich eindeutig gegenüber islamisch-fundamentalistischen Ideologien und sich darauf berufende Gewalttäter:innen abgrenzen müssen. Als Muslima verletzt mich das spürbar werdende Misstrauen. In eine ähnliche Kategorie fallen für mich Fragen wie „Und wie ist das bei Euch so?“ oder „Und zu welcher Ethnie gehörst du?“, die mir im Alltag begegnen. Weicht meine Antwort ab von dem Wissen, das mein Gegenüber zu haben glaubt, muss ich mich erklären. All dies macht mich nicht nur sprachlos, sondern zu einer Anderen, zu einer Fremden. Das schmerzt umso mehr, weil das Fremde, in das ich durch diese Fragen und Forderungen hineinprojiziert werde, nicht notwendigerweise mein Eigenes ist oder als solches anerkannt wird.
Auf der Suche nach Eindeutigkeit
Sowohl die weiße Dominanzgesellschaft als auch Teile der ersten Generation stellen mein Wissen, meine Erfahrungen und möglicherweise sogar meine Gefühle als weniger „authentisch“ in Frage – was auch immer Authentizität im Zusammenhang mit Herkunft und Zugehörigkeit bedeuten soll. Dazu kommt, dass meine Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen, was wiederum dazu führt, dass in der Wahrnehmung Außenstehender, je nach deren Sozialisation und Prägung, verschiedenes überwiegt: deutsch, weil ich hier geboren bin; türkisch, weil mein Vater aus der Türkei stammt; afghanisch, weil ich die Sprache meiner Mutter besser spreche. Es schmerzt, wie von allen Seiten krampfhaft versucht wird, eine Eindeutigkeit in mich hineinzulesen beziehungsweise diese geradezu von mir zu fordern. Gleichzeitig werde ich so immer wieder in eine Lücke gestoßen, die ich nicht füllen kann: Auch ich hätte diese Eindeutigkeit manchmal gerne.
Mein Wunsch nach Eindeutigkeit ist eng verbunden mit einer anderen Art von Schmerz, einem verborgeneren. Gefüttert von der Trauer um einen Ort, den ich nie gehabt habe und den ich möglicherweise auch nie finden werde. Einen Ort, den ich Heimat nennen könnte, weil ich mich an ihm unbeschwert zuhause fühle, ohne mich dafür rechtfertigen oder in Frage stellen lassen zu müssen.
Ganz selbstverständlich dazugehören
Meine Eltern haben diesen Platz: Sie haben Erinnerungen an Orte, zu denen sie gehörten, an eine Gesellschaft, deren Teil sie waren. Sie haben Erinnerungen an eine Zeit, in der ihre Existenz, ihr Dasein nicht in Frage gestellt worden ist. Auch nach über 50 Jahren Leben in Deutschland träumen sie sich weiterhin an jene Orte, zu denen sie ganz selbstverständlich gehörten.
Ich hoffe sehr, dass auch meine Kinder diese Orte finden werden. Dass ihnen die Schmerzen des Suchens und Nicht-Findens erspart bleiben – und dass sich das Gefühl, selbstverständlich dazuzugehören in ihr eigenes Selbstverständnis einschreibt.
Für mich gibt es diesen Ort nicht, und ich habe die Hoffnung aufgeben, ihn in diesem Leben zu finden. Immerhin habe ich einen immateriellen Ort: die Musik aus den Herkunftsregionen meiner Eltern. Zwar schmerzt es, sie zu hören, weil sie an das erinnert, was fehlt. Dennoch macht sie mich glücklich, weil sie keine Fragen stellt, sonst oft unterdrückten Gefühlen Raum gibt und in meinen Gedanken die Orte auferstehen lässt, die ich nicht gefunden habe.
Mehr Arbeiten der Illustratorin Kat Dems finden sich auf ihrem Instagram-Account oder auf ihrer Webseite.