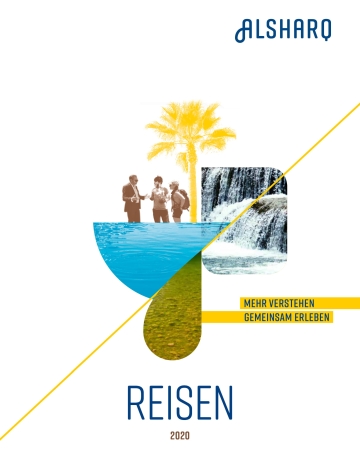Syrer:innen feiern den Sturz eines der brutalsten Regime der WANA-Region. Doch bleibt fraglich, ob die Revolutionsziele „Freiheit und Würde“ von 2011 unter den neuen Machthaber:innen Realität werden können.
Syrien wird seit dem Sturz des Assad-Regimes vom Islamistenbündnis Haiat Tahrir al-Sham („Befreiungskommission Großsyriens“, HTS) regiert. Die neuen Vertreter:innen haben bereits Gäste aus der ganzen Welt empfangen. Auch deutsche Diplomat:innen und Politiker:innen reisten nach Damaskus. Die deutsch-syrischen Gespräche zielten laut Auswärtigem Amt darauf ab, unter Verweis auf die UN-Resolution 2254 einen „inklusiven Übergangsprozess“ und einen „Schutz der syrischen Minderheiten“ zu gewährleisten.
Die Resolution wurde bereits 2015 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet, um die Kämpfe in Syrien zu beenden. Mit einem Waffenstillstand sollte nach der Resolution eine liberale Übergangsregierung eingesetzt, eine säkulare Verfassung ausgearbeitet sowie demokratische Wahlen abgehalten werden. Ob dieser Prozess unter den neuen Machthaber:innen realistisch ist, erscheint aber fraglich. Die HTS, die Baschar al-Assads Sturz angeführt hat, wird von vielen Staaten – darunter auch Deutschland – als terroristische Vereinigung eingestuft.
Wer ist der neue Premier?
Muhammad al-Baschir wurde 1983 in der an die Türkei angrenzenden Provinz Idlib geboren, der letzten Oppositionsbastion Syriens. Er studierte Elektroingenieurswesen an der Universität Aleppo und arbeitete nach seinem Diplom 2007 im staatlichen Gasunternehmen Syriens. Nach dem Ausbruch der Syrischen Revolution 2011 schloss er sich islamistischen Rebellen an. Später nahm er ein weiteres Studium auf und lernte Scharia und Recht an der Universität Idlib. Die Scharia stellt die Gesamtheit der religiös-rechtlichen Normen des Islams dar. Sie findet in islamischen Ländern wie Afghanistan, Iran, Pakistan und Saudi-Arabien ihre Anwendung, wird aber von den syrischen Minderheiten strikt abgelehnt.
Nach seinem Studienabschluss wurde al-Baschir 2022 Minister für Entwicklung und Humanitäre Angelegenheiten in der „Syrischen Heilsregierung“ (SSG). Diese war 2017 von der HTS unter Abu Muhammad al-Dscholani in der Idlib-Provinz ausgerufen worden. Dort wurde er Anfang 2024 vom HTS dominierten Schura-Konzil zum SGG-Chef ernannt. Die Schura stellt das islamrechtliche Prinzip der Beratung dar und bildet in islamischen Staaten die Basis für die Staatsführung. In Idlib war das Schura-Konzil der regierenden SGG übergeordnet und wurde vom HTS-Führer al-Dscholani kontrolliert.
Wer ist der neue Präsident?
Abu Muhammad al-Dscholani wurde als Ahmad al-Sharaa 1982 in Riyad geboren. Seine Familie siedelte sich 1989 in Damaskus an, wo er später Medizin studierte. Er schloss sich 2003 dem Kampf von Al-Qaida im Irak (AQI) an. Nachdem AQI in den Islamischen Staat im Irak (ISI) überging, wurde er Gouverneur von Mossul. Im selben Jahr nahmen ihn US-Streitkräfte gefangen und hielten ihn im US-Camp Bucca fest, wo er sich den dschihadistischen Kriegernamen al-Dscholani („der vom Golan“) zulegte. Damit wollte er auf seine familiäre Abstammung von den syrischen Golanhöhen hinweisen, die von Israel 1981 annektiert wurden.
Zu Beginn der Syrischen Revolution 2011 entsandte das Oberhaupt von Al-Qaida (AQ), Ayman al-Zawahiri, al-Dscholani nach Syrien, um dort einen Ableger aufzubauen. Die Nusra-Front entwickelte sich bald zur durchschlagskräftigsten Gruppe im Kampf gegen die Regierungstruppen – auch weil sie als erste Oppositionsgruppe Selbstmordattentate einsetzte.
Nachdem auch Truppen des AQ-Ableger von der US-geführten „Anti-IS-Koalition“ angegriffen wurden, legte der Dschihadistenführer sein radikal-religiöses Profil ab. Fortan distanzierte er sich von AQ, brach den Kontakt zu dessen Oberhaupt Ayman al-Zawahiri ab und beschwor die Befreiung vom Assad-Regime. Abu Muhammad al-Dscholani gab sich in Bezug auf seine radikale Islamauslegung geläutert, tauschte Tarnkleidung gegen Anzug und ging gegen IS-Überreste vor. So führte die HTS „Antiterroroperationen“ durch, worunter auch die Tötung des IS-Kalifen Abu Hussein al-Qurashi 2023 fiel.
Nach dem Sturz des Assad-Regimes ließ sich al-Dscholani Anfang dieses Jahres zum Übergangspräsident Syriens ernennen. Um seine moderate Linie zu unterstreichen, tritt er nun wieder mit seinem bürgerlichen Namen Ahmad al-Sharaa auf. Trotz seiner radikalen Vergangenheit hat er sein Amt mit dem Versprechen angetreten, die „Minderheitenrechte zu wahren“ und ein „institutionelles Regierungssystem“ in Syrien einzuführen. Allerdings hat er sich in Vergangenheit oft als „pragmatisches Chamäleon“ offenbart, um seine religiös-machtpolitischen Ziele zu erreichen.
Autokratische Ordnungsmacht mit islamischem Profil
Schon 2017 hatten sich islamistische Verbände zur HTS zusammengeschlossen. Nach dem Niedergang des IS-Kalifats 2019 übernahm sie die Führung im Kampf gegen die Regierungstruppen von Baschar al-Assad. In Idlib gelang es der von ihr eingesetzten SSG von Muhammad al-Baschir mit türkischer Unterstützung staatsähnliche Strukturen aufzubauen. Allerdings orientierte sich ihre Gesetzesauslegung am islamischen Kodex, von dem sie „keinerlei abweichende Meinungen“ duldete.
Das Mediennetzwerk Syria Direct berichtete mehrfach, dass die HTS in Idlib Menschen eingesperrt, gefoltert und ermordet hat. Auch dokumentierte es Übergriffe gegen Aktivist:innen, Journalist:innen, Kritiker:innen, darunter insbesondere gegen Frauen. Letztere seien zum Beispiel an den Pranger gestellt worden, wenn sie der Kleiderordnung nicht Folge leisteten. Als Anfang 2024 Proteste gegen die Regierungsform in Idlib auftraten, schlug die HTS diese brutal nieder. Dabei agierten mit ihr verbündete dschihadistische Brigaden besonders brutal, mittlerweile stellen diese Teile des neuen Sicherheitsapparats. Diese sollen auch für die jüngsten Massaker an den Alawiten in der Küstenregion verantwortlich gewesen sein, was das Misstrauen gegenüber der Interimsregierung verstärkt hat.
Die Anführer der Übergangsregierung, al-Sharaa und al-Baschir, haben bereits loyale Gefolgsleute in Schlüsselpositionen von Staat und Armee positioniert. Darunter befinden sich nicht nur einstige AQ-Kommandeure, sondern eben auch solche radikalen Dschihadisten. Daher verwundert es nicht, dass zu ihren ersten Amtshandlungen das Ahnden des Alkohol- und Rauchverbots in der Öffentlichkeit gehörte. Entsprechend wurden bereits islamische Richtlinien im Sicherheitsapparat eingeführt sowie das arabisch-nationale Staatsprotokoll durch islamische Formeln ersetzt.
Quo vadis, Suriya?
Der Interimspremier al-Baschir trat an, das „gesamte syrische Volk“ zu vertreten. Ähnlich inszenierte sich der neue Präsident al-Sharaa in seiner Antrittsrede als „Diener des Volkes“. Er kündigte an, eine Beteiligung aller Syrer:innen „ohne Ausgrenzung und Marginalisierung“ zu gewährleisten. Dazu hat er ein Komitee eingesetzt, das über eine nationale Dialogkonferenz die Ausarbeitung einer neuen Verfassung initiiert. In diesem Prozess sollen die Syrer:innen ihre Zukunft in „Freiheit und Würde“ aufbauen – ein bewusster Bezug auf die Freiheitsforderungen der Syrischen Revolution von 2011.
Das Ergebnis des „Nationalen Dialogs“ wird entscheidend dafür sein, ob es der Interimsregierung gelingt, das Volk zu einen. Dies betrifft besonders die vielen Minderheiten wie die Aramäer:innen, Assyrer:innen und Kurd:innen, genauso wie die Alawit:innen, Christ:innen und Drus:innen. Bei Letzteren wird die Garantie der Freiheit des Glaubens entscheidend für ihre Akzeptanz des syrischen Staates sein.
Nicht wenige von ihnen fürchten, dass die HTS aus Syrien ein islamisches Emirat macht, das Bevölkerungsteile bewusst ausschließt. Eine Befürchtung, die sich mit dem Ausschluss der Kurden auf der ersten Dialogkonferenz bereits bestätigt hat. Zudem ist nach den Erfahrungen in Afghanistan nicht ausgeschlossen, dass die HTS ähnlich wie die Taliban, entgegen ihrem Versprechen nach der Machtkonsolidierung zum radikal-religiösen Kurs zurückkehrt und von der UN-Resolution 2254 letztlich wenig übrigbleibt.
Daher sollten Repräsentant:innen des globalen Nordens nicht, wie kurz nach dem Sturz von al-Assad, über die Rückkehr syrischer Geflüchteter debattieren, sondern am Wiederaufbau eines stabilen und für alle Syrer:innen sicheren Landes mitwirken. Dies bedarf der Einbindung zivilgesellschaftlicher, inter-religiöser und -ethnischer Bewegungen, Organisationen, Stiftungen und Würdenträger Syriens. Sollte dies nicht gelingen, könnten sich in Zukunft noch mehr Syrer:innen dazu gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen.