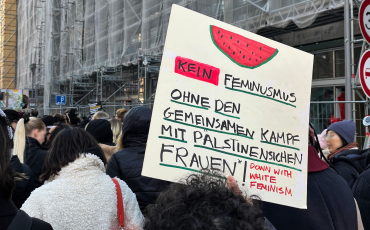Vom Anwerbeabkommen 1963 bis zur Debatte über Marokko als „sicheren Herkunftsstaat“ - Karima Benbrahim von IDA-NRW spricht über Selbst- und Fremdwahrnehmung der deutsch-marokkanische Community zwischen Rabat und Berlin.
Karima Benbrahim ist Leiterin des „Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen“ (IDA-NRW) mit Sitz in Düsseldorf. Zudem engagiert sich Frau Benbrahim ehrenamtlich für „Zukunft Plus“, ein Verein, der sich für gesellschaftliche Teilhabe und das Einbringen von maghrebinischen Perspektiven in die Mehrheitsgesellschaft einsetzt.
Frau Benbrahim, im größeren Umfang begann die Migration aus Marokko nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Anwerbeankommen von 1963[1]. Trotzdem spielt Marokko im deutschen Narrativ der „Gastarbeiter:innen“ nur eine marginale Rolle. Wieso?
Zunächst liegt das an der Geschichte: Marokkanische Arbeitsmigrant:innen sind hauptsächlich in französischsprachige Länder gegangen, bedingt durch die Sprache und die Kolonialzeit. Deswegen gibt es eine größere Community in Frankreich und Belgien. Aber auch in den Niederlanden. In Deutschland verlief die Anwerbung entlang der gebrauchten Fähigkeiten: Die meisten Migrant:innen kamen aus dem marokkanischen Rif-Gebirge, wo es Steinkohle-Bergbau gab. Sie kamen vor allem ins Ruhrgebiet, nach Nordrhein-Westfalen, aber ihre Anzahl war verglichen mit Arbeitsmigrant:innen aus anderen Ländern gering.
Wie lässt sich die Selbstorganisation innerhalb der ersten Dekaden deutsch-marokkanischer Migrationsgeschichte beschreiben?
Früher erfolgte die Organisation vor allem in herkunftsbezogenen Vereinen, mit ihnen bin ich quasi aufgewachsen: Arabisch lernen, Wertschätzung und Erlernen kultureller und religiöser Feste, Koranunterricht. Aber es ging selbstverständlich darüber hinaus: Unter Deutsch-Marokkaner:innen gibt es eine starke Amazigh-Kultur, mit den verschiedenen Sprachen wie Tamazight, Taschelhit und Tarifit. Meine Eltern sind zum Beispiel im Süden Marokkos geboren und haben andere kulturelle und regionale Bezüge als jemand aus dem Rif-Gebiet.
Man kann also nicht von einer homogenen marokkanischen Identität ausgehen. In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland fielen Deutsch-Marokkaner:innen noch im Diskurs der 90er Jahre unter den Sammelbegriff „Ausländer“ und bis heute gibt es kein differenziertes Bild von der Community.
Woran liegt das?
Das hat verschiedene Ursachen: Zum einen ist durch die Migration eine ungleiche Verteilung von Deutsch-Marokkaner:innen im Bundesgebiet entstanden. Es gibt Ballungsgebiete, vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. Im Vergleich zur türkisch-stämmigen Community oder zur neueren syrischen Community sind Deutsch-Marokkaner:innen andernorts marginal. Die erste Generation von sogenannten „Gastarbeiter:innen“ haben hauptsächlich herkunftsbezogene Vereine und Initiativen gegründet, die sich auf die kulturelle und nationale Identität fokussiert.
Inwieweit hat sich das gewandelt?
Viele Deutsch-Marokkaner:innen verstehen sich nicht mehr nur als kulturell marokkanisch, sondern als muslimisch und sind teilweise in Verbänden aktiv, in denen die nationale Herkunft eine viel geringere Rolle spielt. Es gibt seit den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 eine starke Bekennung zur Religion. Seitdem stehen Muslim:innen stark im Fokus des öffentlichen Diskurses und werden in Deutschland, sowie in ganz Europa diskriminiert.
Somit bedingen sich Eigen- und Fremdwahrnehmung als Muslim:in und führen zu einer Verstärkung der muslimischen Identität beziehungsweise der Selbstwahrnehmung als Muslim:innen. Es gibt heute aber auch immer mehr Vereine, in denen es nicht nur um die religiöse und nationale Identität, sondern die politische Selbstfindung und um die Frage der Zugehörigkeit geht. Der Ausblick ist: Wir sind Deutsche mit marokkanischen Wurzeln und wollen sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch nach innen in die Community wirken und mitgestalten.
Können Sie Beispiele nennen?
Der Verein Zukunft Plus ist ein gutes Beispiel. Zukunft Plus ist eine Selbstorganisation von deutsch-marokkanischen Menschen, die sich als Teil der Gesellschaft in Deutschland verstehen. Ziel ist es, insbesondere jungen Menschen und Multiplikator:innen ein breites Angebot im Bereich der politischen Bildung, Politik, Kunst und Kultur zu machen, um eine Stimme, Sichtbarkeit und positive Selbstwahrnehmung in der Migrationsgesellschaft zu ermöglichen. Der Verein bietet eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung maghrebinisch-deutscher Perspektiven mit einem gesellschaftskritischen Blick auf Bildung, Kunst und Kultur sowie auf Medien und Politik. Deutsch-Marokkaner:innen sollen auf gesellschaftliche Diskurse in Deutschland reagieren und selbst Diskurse anstoßen.
Und darüber hinaus?
Es gibt wie gesagt Initiativen und Selbstorganisationen, die sich auf die kulturellen oder religiösen Angebote konzentrieren, aber auch menschenrechtsorientierte Initiativen mit dem Fokus auf Frauenrechte und LGBTQI. Diese sind in ihrer Arbeit auch nicht unbedingt auf Marokko beschränkt. Das Be'kesh in Berlin etwa. Es gibt neue Formatierungen, die sich solidarisieren und Allianzen schmieden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Denn in der Mehrheitsgesellschaft sind wir einem starken antimuslimischen Rassismus sowie anderen Diskriminierungen ausgesetzt. Es gibt einen politischen Rechtsruck in ganz Europa, auch global. Das macht sich bemerkbar in den Formen von Zukunftsängsten, die man auch in der Community spürt. Wir haben religiös begründeten Terrorismus, beispielsweise Jihadismus. Das sind alles Themen, die in den Communities eine Rolle spielen. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass sich Menschen gegenseitig empowern möchten, zu einer Stärkung nach innen; dass Menschen ihre eigenen Werte, Kultur, Diskriminierungserfahrungen thematisieren wollen und andere Themen haben, als es in der Moscheegemeinde oder im herkunftsbezogenen Verein der Fall ist.
Der von Ihnen angesprochene Rechtsruck hat sich seit den Fluchtbewegungen von 2015 noch verstärkt. Der Ton ist seither immer rauer geworden, 2017 zog mit der AfD eine rechtsnationale Partei in den Bundestag ein. Wie haben die verschiedenen Teile der deutsch-marokkanischen Community darauf reagiert?
Es gibt einen großen Teil der Community, dem das große Sorgen bereitet, da sich die Spaltung in der Gesellschaft besonders auf Muslim:innen und rassifizierte Communities negativ auswirkt. Es gibt aber auch Stimmen, die die Argumentationen von Rechten anschlussfähig machen. Dies kann man im Kontext der Geflüchteten gut beobachten. Rechte Argumentationen werden auch in der Community unbewusst aufgenommen, weil sich der öffentliche Diskurs nach rechts verschoben hat.
Dies verdeutlicht, dass auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, rechte Argumentationsmuster übernehmen. Oft sind das Menschen, die selbst nach Deutschland migriert sind, sich etwas aufgebaut haben und gemäß der Art, wie es der Soziologe Norbert Elias beschreibt, Angst haben, die hart erarbeiteten Privilegien in der Gesellschaft zu verlieren. Dennoch hat der Großteil Verständnis dafür, dass Menschen aus Marokko versuchen, sich in Deutschland eine Existenz aufzubauen, obwohl es politisch nicht gewollt ist und sie kaum eine Chance auf Asyl haben.

Warum versuchen heute viele Marokkaner:innen trotz aller Wiederstände, ihr Glück in Europa zu finden?
Wenn wir uns in Marokko die Arbeitslosenquote anschauen, fällt auf, dass es mehrheitlich junge Menschen sind, die keine Perspektive haben. Es wundert mich nicht, dass sie über das Meer wollen. Ein Ansatz könnte sein, gute Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven in Marokko zu schaffen. Das Problem ist, dass viele Menschen ohne Arbeit gut ausgebildet sind und längst einen Universitätsabschluss besitzen, aber damit keine gute Arbeit finden.
Die hohe Arbeitslosenquote ist nur eine Dimension von vielen sozio-ökonomischen Problemlagen Marokkos: Die marokkanische Gesellschaft ist stark gespalten in Privilegierte und Deprivilegierte, die Schere zwischen Armen und Reichen ist sehr groß. Die Infrastruktur in den ländlichen Regionen ist immer noch zu schwach, die Analphabet:innenrate hoch und die Rolle der Frau in der Gesellschaft weiterhin prekär. Die kolonialen Spuren sind längst nicht überwunden. Ganz im Gegenteil: die koloniale Vergangenheit hat die Zwei-Klassengesellschaft etabliert und fortgesetzt, mit einem französischem Bildungssystem und wirtschaftlichen Monopolinteressen.
Können Sie das näher erläutern?
Marokko wurde jahrelang von der französischen Kolonialmacht besetzt. Das hat bis heute schwerwiegende Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Marokkos. Das erwähnte frankophone Bildungs- und Schulsystem privilegiert jene, die über die finanziellen Mittel verfügen. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, etwa Tagelöhner:innen, können weiterhin ausgebeutet werden, da wenig Arbeitsplätze existieren und viele Arbeitskräfte vorhanden sind. Das schafft einen großen Wettbewerb und gleichzeitig können Großbesitzer Arbeitskräfte unterbezahlen.
Die Regierung hat versucht, das zu regulieren. Aber es bleibt ein großes Problem. Gewinner sind die Groß- und Landbesitzer, die weiterhin ihre Macht und Privilegien besitzen und die guten Abschlüsse in französischen Schulen garantiert bekommen. Wer gute Kontakte hat und französischsprachige, beziehungsweise internationale Diplome vorweisen kann, kriegt überall einen Job. Die Nachfrage nach europäischen Abschlüssen ist höher denn je. Der Rest, der nicht mitkommt und abgehängt wird, kann kaum im Land überleben.
Nun standen speziell Geflüchtete aus Marokko im Fokus, nachdem es in der Silvesternacht 2015/16 in Köln zu sexualisierter Gewalt und Diebstählen kam. Wie haben Sie die Reaktionen innerhalb der Community in Nordrhein-Westfalen wahrgenommen?
Es gab Wut und Distanzierung. Viele Deutsch-Marokkaner:innen sagten: Mit denen haben wir nichts zu tun! Wir sind hier seit 20, 30 Jahren, zahlen Steuern und werden jetzt als „Antänzer“ und Kriminelle wahrgenommen. Am Ende kam raus, dass es gar nicht so viele Männer waren und auch gar nicht so viele Marokkaner. Aber es ist etwas ins Rollen gekommen, medial und diskursiv, dass die Stigmatisierung von Deutsch-Marokkaner:innen verstärkt hat.
Nach der Silvesternacht gab es verstärkt Razzien in der marokkanisch geprägten Ellerstraße in Düsseldorf. Dokumente wurden kontrolliert, allein weil Menschen „maghrebinisch“ aussahen. Das hat zu viel Unmut geführt. In den sozialen Medien sind mehrere Fälle unverhältnismäßiger und rassistischer Polizeigewalt gegenüber Arabisch aussehenden Menschen und People of Color sichtbar geworden. Viele Männer berichten von Racial Profiling und fühlen sich diskriminiert.
Läuft die gesellschaftliche Diskriminierung von (Deutsch)-Marokkaner:innen in Bezug auf Geschlecht unterschiedlich ab?
Junge Männer haben durch die Ereignisse in Köln besonders viel Racial Profiling zu spüren bekommen. Sie wurden zum „Nafri“ erklärt – dem Nordafrikanischen Intensivtäter. Es gibt eine Überlappung: Der Nafri und der Musli. Wenn man etwa einen Bart trägt, wird das als fremd wahrgenommen. Medien bedienten sich in der Darstellung der Ereignisse rassistischer und koloniale Bilder: Der triebhafte Orientale. Der gewaltbereite Maghrebiner, der über die weiße, blonde – oder in dem Fall deutsche – Frau herfällt. Deutsch-Marokkaner:innen müssen sich allgemein ständig dafür rechtfertigen, Teil dieser Gesellschaft zu sein, auch wenn sie hier geboren worden. Das ist bei Frauen nicht anders.
Besonders Frauen, die ein Kopftuch tragen, werden rassistisch beleidigt oder auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt diskriminiert. Ich gebe viele Workshops, bei denen mir Mädchen und junge Frauen erzählen, was sie an rassistischem Alltag erlebt haben, wenn sie ein Studium machen und in höhere Berufe gehen wollen, etwa als Lehrerin. Das Kopftuchverbot an Schulen wurde in Nordrhein-Westfalen zwar 2015 abgeschafft, in der Praxis angekommen ist das aber nicht.
Im Jahr 2019 beschloss der Bundestag, Algerien, Tunesien, Georgien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Eine Entscheidung, die die Chancen auf Asyl für Staatsangehörige der entsprechenden Länder massiv schmälern. Noch ist das Gesetz nicht in Kraft, weil sich der Bundestag weigert, zuzustimmen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Das ist ein riesiges Problem, weil Marokko kein sicheres Herkunftsland ist und es sich Deutschland beziehungsweise Europa damit sehr einfach macht. Zum Beispiel gibt es Minderheiten und Menschen aus der LGBTQI Community, die aufgrund dieser Flucht- und Asylpolitik in Deutschland kein Asyl beantragen können. Wie wird man da weiter vorgehen?[2] Seit Jahren lässt sich beobachten, dass die Asylgesetze in Deutschland verschärft werden und das direkte Konsequenzen für geflüchtete Menschen hat.
Was schlagen Sie vor?
Es bedarf politischer Lobbyarbeit; das Gespräch von Betroffenen aus der Community mit der deutschen Politik beziehungswiese den Parteien. Wir brauchen eine humane Asyl- und Migrationspolitik, die zum einen die Fluchtursachen bekämpft und die Geflüchteten schützt. Oppositionelle und Aktivist:innen müssen geschützt werden, sowohl in Marokko als auch hier im Exil. Außerdem gibt es auch in Marokko viele Geflüchtete, die aus anderen afrikanischen Ländern über die Sahara kommen. Marokko ist damit selbst Aufnahme- und Transitland. Die Thematik ist sehr komplex. Deshalb glaube ich, dass wir keine Politik der Abschottung brauchen, sondern nur eine langfriste menschenrechtsorientierte Politik, die einen nachhaltigen Effekt auf Marokko und Europa hat.
[1] Die ersten Anwerbeabkommen für „Gastarbeiter:innen” wurden 1955 geschlossen. Das erste Abkommen zwischen Deutschland und Marokko trat 1963 in Kraft. Bis zum Anwerbestopp 1973 kamen 22.400 marokkanische Gastarbeiter:innen nach Deutschland)
[2] Als „sicherer Herkunftsstaat“ gilt ein Land, „[…] wenn dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und [...] der jeweilige Staat grundsätzlich vor nichtstaatlicher Verfolgung schützen kann […]“ (Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Angehörige dieser Staaten haben weiterhin die Möglichkeit, in Deutschland Asyl zu beantragen, sind rechtlich aber schlechter gestellt als andere Asylsuchende und die Chancen auf Bewilligung ihrer Anträge sind weitaus geringer.