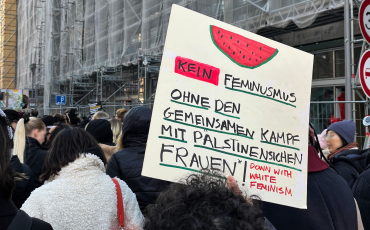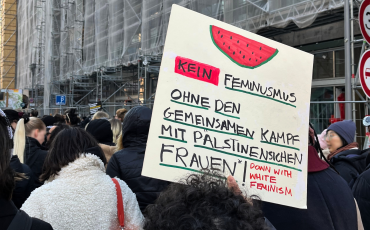100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gedachte man bei der zentralen Zeremonie in Paris erstmals auch einer bisher marginalisierten Gruppe: Der zahlreichen Opfer und Arbeiter*innen aus den Kolonien. Doch um in Zukunft endlich den globalen Dimensionen dieses Kriegs gerecht zu werden, sollten die großen Gedenkfeiern auch außerhalb Europas stattfinden. Von Daniel Walter
Es war ein grauer, regnerischer Tag in der französischen Hauptstadt. Während der Hauptzeremonie zum Gedenken an das 100-jährige Ende des Ersten Weltkriegs saßen die Staats- und Regierungschefs daher unter einer transparenten Dachkonstruktion. Dem Anlass entsprechend kleideten sich die Gäste in schwarz, einzig die herbstlich gefärbten Bäume rund um den Triumphbogen sorgen für Farbkleckser – und die rund 70 Nationalflaggen, die hinter der Gästetribüne aufgebaut waren.
Es waren sehr viel mehr Flaggen als in den Jahren zuvor. Denn an diesem Tag wurde in Paris erstmals auch der insgesamt etwa vier Millionen Menschen aus europäischen und amerikanischen Kolonien gedacht, die im Ersten Weltkrieg als Soldaten kämpften oder als Arbeiter*innen dienen mussten. Die Gäste kamen daher neben Europa und Amerika auch aus Afrika und Asien. Man trage eine „Schuld“ gegenüber diesen Ländern, ließ der Élysée im Vorfeld verlauten.
Entsprechend war auch das Protokoll der Gedenkveranstaltung darauf bedacht, nicht den Eindruck einer französischen oder Entente-Siegesfeier aufkommen zu lassen. Auf eine Militärparade wurde daher verzichtet. Auch die sonst üblichen Limousinenkorsos der Regierungschefs wurden zugunsten einer gemeinsamen Busfahrt ausgetauscht. Im Zentrum sollte das Gedenken an die Opfer und das Leid der Hinterbliebenen des Krieges stehen.
Der chinesisch-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma und die beninisch-französische Sängerin Angelique Kidjo sorgten für musikalische Einlagen. In verschiedenen Sprachen vorgetragenen Tagebucheinträge und Briefe – etwa eines chinesischen Hilfsarbeiters – sollten die Eindrücke von Zivilisten und einfacher Bevölkerung am 11. November 1918 offenbaren.
Nach einhundert Jahren nicht selbstverständlich?
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dieses in Frankreich zentrale Datum also als Trauerfeier gedeutet. Das ist ihm zunächst einmal hoch anzurechnen, angesichts der Widerstände nicht nur aus der französischen Rechten, sondern auch der revisionistischen Trends in weiten Teilen der Welt und Europas. Das Foto mit der deutschen Kanzlerin im Wald von Compiègne war ein starkes, wichtiges Symbol in Zeiten wachsenden europafeindlichen Zynismus.
Gleichzeitig stößt dieser Versuch der Inklusion schnell an seine Grenzen. Nicht nur, weil Macron kurz zuvor den Nazi-Kollaborateur Philippe Pétain als „großen Soldaten“ geehrt und damit Jüdinnen und Juden verhöhnt hatte. Auch nicht, weil Macron Patriotismus als „Gegenteil“ von Nationalismus beschwor (sind Streichhölzer also das Gegenteil von Feuer?)
Es beginnt vielmehr schon beim Datum, schließlich markierte der 11. November 1918 das Ende des Krieges an der – aus hiesiger Perspektive – Westfront. In Russland, um nur ein Beispiel zu nennen, dauerte das Morden in Form eines Bürgerkriegs noch bis 1922 an.
Noch eklatanter wird diese Limitierung, schaut man auf die Entwicklungen in den Kolonien oder den Nachfolgestaaten des erodierenden Osmanischen Reichs. Mit dem Sykes-Picot-Vertrag von 1916, der Balfour-Erklärung von 1917 und den Verträgen von Sèvres von Sanremo im Jahr 1920 wurden in Westasien die Grenzen gezogen, die noch heute ein Hauptbestandteil der fehlenden Friedensperspektive in der Region sind.
Irak, Syrien, Libanon und das Britische Mandat Palästina, die Kurden- und Armenierfrage sowie die ethnische Säuberung des türkischen Nationalstaats sind nur einige der direkten Folgen, die dem Ersten Weltkrieg entwuchsen. Sie alle prägen die Politik dort bis heute fundamental. Als Extrembeispiel sei an die Bilder erinnert, wie die Terroristen von Daesh die syrisch-irakische Grenze symbolisch planierten.
Die Auswirkungen des Krieges auch in Afrika und Asien zu beleuchten, ist hier nicht möglich. Allein 2,5 Millionen Menschen aus den Kolonien kämpften für das Britische Empire. Auch ihre Geschichte wird marginalisiert, wenn etwa in Christopher Nolans Blockbuster über die Schlacht von Dunkirchen im Zweiten Weltkrieg nur blonde Jungs aus Manchester oder Brighton zu sehen sind.
Frankreich hingegen deportierte eine halbe Million Menschen aus den afrikanischen Kolonien nach Europa, um an der Front zu kämpfen oder in den Fabriken zu arbeiten – aus dem heutigen Senegal, Algerien, Tunesien, Marokko oder Somalia. Es sollte bei einer Gedenkfeier 100 Jahre später nicht weniger als eine Selbstverständlichkeit sein, dass auch ihrer gedacht wird.
Den Krieg in seiner Kontinuität begreifen – und global gedenken
Der Erste Weltkrieg war also am 11. November 1918 für viele Menschen nicht „vorbei“. Wichtiger noch: Trotz historischer Ereignisse wie Grenzziehungen und dem Zerfall von Imperien war er für den Großteil der Welt auch nichts Außergewöhnliches.
In einem brillanten Text aus dem Jahr 2017 hat der Essayist Pankaj Mishra vielmehr herausgearbeitet, dass der Krieg einzig für Europa eine historische Ausnahme darstellte. Für die Kolonisierten weltweit war diese Art der (rassistischen) Brutalität im Alltag seit Langem Realität. Die Zeit zwischen 1914 und 1918 markierte daher den Punkt, an dem die koloniale Gewalt zu ihrem Ausgangspunkt zurückkam. Ein Bumerang der imperialen Gewalt, wie Mishra es ausdrückt.
Begreift man den Krieg globalgeschichtlich, als Kontinuum von Imperialismus und Kapitalismus mit wechselnden regionalen Schwerpunkten, treten auch die Wurzelteile des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust deutlicher hervor. Seien es die „Konzentrationslager“, die zuerst auf dem Boden afrikanischer Kolonien von Briten und Deutschen getestet wurden, oder der aggressive Rassismus, der die Herabwertung menschlichen Lebens ermöglichte.
Was folgt daraus also für die Abhaltung einer Gedenkzeremonie? Dass dem 100. Jahrestag in Paris und dem Wald der Compiègne gedacht wurde, ist verständlich und war wichtige Symbolpolitik für die Europäische Union. Doch gerade weil Symbolpolitik ein starkes Zeichen setzen kann: Warum findet die nächste große Gedenkveranstaltung nicht in einer der Städte statt, die bis heute viel stärker von den Folgen des Krieges und des europäischen Imperialismus gezeichnet sind?
Die Liste an möglichen Orten wäre lang. Ob Mossul oder Diyarbakir, ob Amman, Algiers oder Windhoek. Ein Gedenken außerhalb des ehemaligen imperialen Zentrums würde die Deutungshoheit anderen überlassen. Es wäre eine ehrlichere, weniger paternalistische Art des Gedenkens als dieses Jahr in Paris; sicher auch utopisch, ein stückweit. Aber nichts anderes war vor wenigen Jahrzehnten schließlich das gemeinsame Gedenken Frankreichs und Deutschlands.