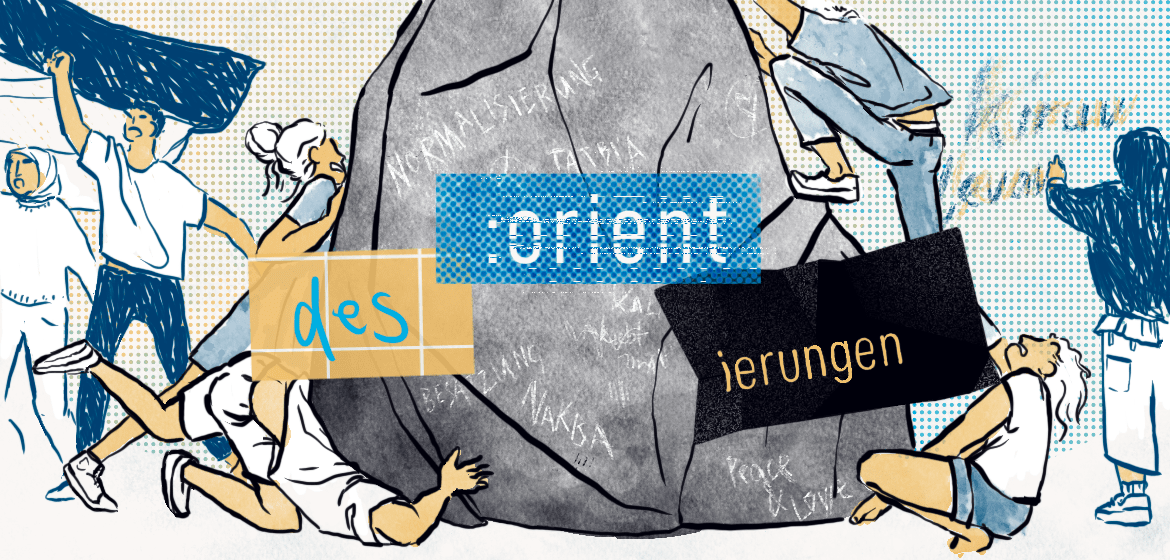Dürfen radikale israelische Linke über den Schmerz der Anti-Normalisierung sprechen? Ja, sagt Marina Klimchuk, solange sie weiter gegen die Besatzung kämpfen. Selbst dann, wenn sie von palästinensischer Seite dafür niemals Anerkennung bekommen werden.
Es gibt Themen im Israel-Palästina-Konflikt, über die sprechen linke israelische Aktivist:innen ungerne. Auch, weil sie in den Ohren anderer illegitim klingen mögen. Wir wollen Solidarität zeigen und Alliierte im Kampf gegen die israelische Besatzungspolitik sein. Aber diese Rolle bedeutet auch, dass wir uns den Raum für Zwischentöne hart erkämpfen müssen.
Die Frage der Normalisierung – Tatbi'a auf Arabisch – ist eines dieser schwierigen Themen. Normalisierung bedeutet in diesem Kontext die Ablehnung palästinensischer Menschen oder Institutionen, die mit israelischen Menschen und Institutionen Beziehungen, Projekte oder Aktivitäten pflegen, weil dadurch der Zustand der Besatzung „normalisiert“ würde. „Brücken bauen“ wird dann zum zynischen Negativbegriff.
Unverzeihliche Kollektivschuld
Normalisierung heißt zum Beispiel an Sommercamps in den USA teilzunehmen, die israelische und palästinensische Jugendliche zusammen bringen: sie lernen sich als Menschen in einem depolitisierten Umfeld kennen, wo nur die zwischenmenschliche Ebene eine Rolle spielt. Sie ignorieren ihre Differenzen, ohne die Asymmetrie der politischen Situation zu konfrontieren. Nach dem Camp kehren die Jugendlichen wieder in ihre alte Realität zurück: die Palästinenser:innen in die Unterdrückung, israelische Jugendliche müssen kurze Zeit später entscheiden, ob sie Teil der Armee werden.
Andere Jugendprogramme wie Kids4Peace, haben einen höheren politischen Anspruch. Sie legen den Finger in die Wunde und sprechen genau diese Ungerechtigkeiten an, geben ihnen Raum und die Jugendlichen hören einander zu. Es werden dort Werkzeuge beigebracht, um mit den Komplexitäten des Konflikts zu arbeiten. Das ist schwieriger und unbequemer.
Komplexität und Ambivalenzen interessieren viele Palästinenser:innen aus arabischen Ländern, Gaza und dem Westjordanland allerdings überhaupt nicht. Sie wollen Israelis weder kennenlernen noch mit ihnen zusammenarbeiten, egal wie diese ticken. Sie sehen sie als einheitliche Gruppe, der eine unverzeihliche Kollektivschuld anhaftet. Sie wollen nichts mit jüdischen Israelis zu tun haben, zumindest nicht, solange diese sich nicht explizit für das Recht auf Rückkehr aussprechen. Genau diese Forderung öffnet jedoch eine ganz eigene Box der Pandora.
„Die Nakba geht immer weiter“
Viele politisch aktive Palästinenser:innen erklären Akte der Normalisierung damit, dass man es sich in der Unterdrückung bequem gemacht habe. Sie sei eine „Kolonialisierung des Geistes“, durch die das unterdrückte Subjekt – also sie selbst – in einer erlernten Hilflosigkeit zu der Überzeugung gelangt, die Realität des Unterdrückers sei die einzige „normale“ Realität, die hingenommen werden müsse, eine Tatsache des Lebens. Diejenigen, die sich für Normalisierung einsetzen, ignorierten diese Unterdrückung oder akzeptieren sie als den Status quo.
„Die Nakba geht immer weiter“, sagen meine palästinensischen Freund:innen oft und meinen damit nicht nur den historischen Schmerz der Vertreibung und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, sondern die anhaltende Unterdrückung durch Israel.
Dabei gibt es ein Spektrum, welche Art von „Normalisierung“ akzeptiert wird und welche nicht. Die Logik dahinter ist nicht immer eindeutig zuzuordnen oder wird konsequent gehandhabt – in Städten im Westjordanland wie Ramallah oder Nablus ist jede Art von Interaktion mit Israelis verpönt und sozial stigmatisiert, gerade unter gebildeten Palästinenser:innen. Einige machen ihre Entscheidung abhängig von der Art der Zusammenarbeit. Anderen ist alles Politische einfach egal.
In palästinensischen Dörfern im Westjordanland wiederum sind es manchmal gerade israelische Aktivist:innen, die die Menschen dort seit Jahren vor der Brutalität von Armee und Siedler:innen beschützen und gemeinsam mit den Dorfbewohner:innen gegen sie kämpften. Die in Ramallah geforderte radikale Anti-Normalisierung ist in solchen Dörfern fern der Realität.
Für Palästinenser:innen, die israelische Staatsbürger:innen sind, ist Anti-Normalisierung ebenfalls keine Option: sie kennen jüdische Israelis, arbeiten und studieren mit ihnen, sie können sich nicht von ihnen abkoppeln.
Die jüdisch-israelische Linke ist gespalten. Einige sehen die politische Ungerechtigkeit und wollen etwas tun, wissen aber oft nicht so genau wie, weil niemand es ihnen beigebracht hat. Sie rutschen in gutgemeinte Dialoggruppen, meistens mit palästinensischen Israelis, die ihrerseits aber von den meisten Palästinenser:innen mit politischem Bewusstsein verachtet werden.
„Annäherung der Herzen“ statt politischem Klartext
Einige Israelis baden tatsächlich gerne in der wohligen Wärme apolitischer Dialoggruppen und klopfen sich dann auf die Schultern, stolz, eine:n palästinensischen Freund oder Freundin zu haben. Kiruv levavot nennen sie das, die Annäherung der Herzen. Was wirklich zählt, sagen sie, sei die menschliche Begegnung. Politik, damit wollen sie nichts zu tun haben. Wörter wie „Besatzung“ oder „Nakba“ nehmen sie ungern in den Mund.
Andere linke, nicht zionistische Israelis verstehen, dass der politische Status Quo schon lange nicht mehr haltbar ist. Sie sprechen sich gegen die Regierung und gegen die zionistischen Narrative aus, von denen sie ihr Leben lang geprägt wurden. Sie verstehen, dass Israelis nur eine Zukunft haben, wenn ihre palästinensischen Nachbar:innen es auch tun. Je nachdem, aus welcher Familie jemand kommt und wie jemand aufwuchs, erfordert das viel Mut.
Dieser Teil der jüdisch-israelischen Linken verstehen die Forderung nach Anti-Normalisierung aus Sicht von Palästinenser:innen. Sich mit der Forderung zu solidarisieren ist naturgemäß schwierig: Sie nimmt ihrem politischen Aktivismus die Existenzgrundlage. Oder sie bedeutet, sich mit der Aufforderung zu solidarisieren, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen.
Natürlich ist all das im täglichen Leben längst nicht so klar voneinander abgrenzbar. Es gibt Freundschaften und enge Zusammenarbeit zwischen israelischen und palästinensischen Menschen, Normalisierung hin oder her. Dazu gehören Organisationen wie Parents Circle, wo Familien auf beiden Seiten Angehörige an den Konflikt verloren haben. Oder Combatants for Peace, eine Graswurzelbewegung, die sich in Israel und den Palästinensischen Autonomiegebieten in Form von gewaltlosem Widerstand dafür einsetzt, die Besatzung zu beenden.
Sollten wir deshalb aufgeben?
Normalisierung bleibt ein schwieriges und schmerzhaftes Thema. Denn im Grunde bedeutet es ja: Wir kämpfen mit unseren Ressourcen und unserer Energie für die Befreiung eines Volkes, in dem uns sehr viele Menschen nicht als Individuen sehen, sondern uns eine Kollektivschuld zuschreiben.
Das ist aus palästinensischer Perspektive und ihrer Erfahrung mit Israelis verständlich, tut aber einer Einzelperson weh. Habe ich im aktuellen politischen Klima das Recht, diesen Schmerz anzusprechen? Ich weiß es nicht. Klingt es so, als ob ich das Opfersein an mich reiße? Hoffentlich nicht. Machen wir das alles für die Anerkennung und dafür, um gesehen zu werden und uns gut zu fühlen? Natürlich nicht. Aber wir alle wollen die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit spüren. Ich weiß, dieser Schmerz ist politisch irrelevant. Selbst das Aufschreiben fühlt sich illegitim an. Tabuthemen eben.
Sollten wir deshalb aufgeben oder wütend sein? Nein, natürlich nicht. Radikale linke Israelis müssen weiter machen, weil es das einzig Richtige ist. Dafür müssen sie nicht in allen Punkten mit ihren palästinensischen Kolleg:innen übereinstimmen – solange wir uns darauf einigen, dass die Besatzung beendet werden muss. Selbst dann, wenn die Israelis von palästinensischer Seite dafür niemals Anerkennung bekommen werden.