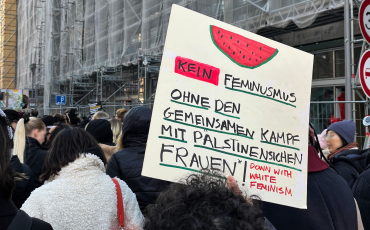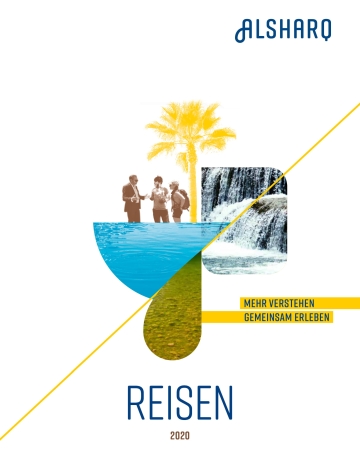Daniel Marwecki seziert in seinem neu übersetzten Buch die Geschichte der israelisch-deutschen Beziehungen. Er zeichnet nach, wie sich die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg Absolution bei Israel und den westlichen Staaten erkaufte.
„Wenn die Deutschen über Israel reden, reden sie zumeist über sich selbst“, zitiert Daniel Marwecki in der Einleitung seines Buches „Absolution? Israel und die deutsche Staatsräson“ einen Freund. Der 1948 gegründete Staat spiele für das deutsche Selbstbild eine große Rolle. In der deutschen Übersetzung seiner 2019 erschienenen Dissertation analysiert der Politikwissenschaftler die deutsch-israelischen Beziehungen. Er unterstellt eine Leerstelle in der Debattenkultur: Während in der deutschen Politik viel über Israel geredet würde, ginge es zu selten um die realen politischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Der politische Blick auf Israel fungiere in Deutschland bis heute als Spiegel, um sich der eigenen moralischen Integrität zu vergewissern.
Marwecki hat im Rahmen seiner Forschung in den Archiven des Auswärtigen Amts recherchiert. In seinem Buch gliedert er die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel in drei große Phasen und erklärt, welche unterschiedlichen Ziele beide Staaten von Beginn an mit den Beziehungen verfolgten.
Absolution vs. Überleben
Die ersten Kapitel widmet der Autor der Analyse des Luxemburger Abkommens von 1952, im Rahmen dessen Westdeutschland sich bereit erklärte, 3,5 Milliarden Mark an den jungen israelischen Staat zu zahlen. Der damalige westdeutsche Kanzler Konrad Adenauer sei von dem Willen getrieben worden, Deutschland zu rehabilitieren. Laut Marwecki stand nach Ende der Naziherrschaft vor allem die moralische Absolution bei den Westmächten, allen voran der USA, im Vordergrund – Buße und moralische Verantwortung waren zweitrangig.
Demgegenüber seien die militärischen und wirtschaftlichen Hilfen Deutschlands für das junge Israel von Beginn an eine überlebenswichtige Notwendigkeit gewesen: „Nicht Vergebung oder Versöhnung, sondern blanke Not trieb das junge Israel Richtung Bundesrepublik.“ Und dass, obwohl die meisten Israelis zu dieser Zeit berechtigterweise keinen Unterschied zwischen dem Deutschland während und nach 1945 machten. Entsprechend kontrovers wurden die Beziehungen zu Deutschland von großen Teilen der israelischen Politik und Gesellschaft bis weit in die folgenden Jahrzehnte betrachtet.
Doch der Autor stellt die Aussichtslosigkeit der israelischen Situation heraus: Israels wirtschaftliche Lage war kurz nach der Staatsgründung prekär, das Land konnte dem rasanten Bevölkerungsanstieg durch die Vertriebenen aus Europa und verschiedenen arabischen Staaten kaum standhalten. Laut Marwecki lieferten die deutschen Reparationen ein „Investitionsprogramm für die israelische Industrie“; ihr Abschlussbericht lese sich wie eine „Step-by-step“-Anleitung dafür, wie man einen Agrar- in einen Industriestaat verwandelt.
Gescheiterte Normalisierung und Staatsräson
Deutschland war durch seine finanzielle Unterstützung bis in die 1960er Jahre die zentrale westliche Schutzmacht Israels. Marwecki zeichnet nach, wie die deutsche Politik in der Mitte der 1960er Jahre auf aggressive Weise versuchte, einen Politikwechsel hin zu einer stärkeren Normalisierung der Beziehungen zu Israel einzuleiten. Zudem drängte Westdeutschland zu diesem Zeitpunkt nicht nur aufgrund wirtschaftlicher Interessen darauf, die eigenen Beziehungen zu den arabischen Nachbarstaaten zu verbessern. Doch die Normalisierung verlief trotz der offiziellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1965 holprig. Die Israelis waren von der Einsetzung des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers Rolf Pauls als erstem deutschen Botschafter brüskiert. Währenddessen schreckte der erste israelische Botschafter in Deutschland nicht davor zurück, justizielle Versäumnisse der deutschen Vergangenheitspolitik zu kritisieren.
Eine Staatsräson im besten Eigeninteresse
Mit Ende des kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung wurde laut Marwecki die Beziehungsphase der Staatsräson eingeleitet. Die Kombination aus außenpolitischen Faktoren und der erinnerungspolitischen Wende manifestierte sich, so der Autor, in dieser speziellen Form der Israelpolitik. Die „Staatsräson in Action“ beschreibt Marwecki vornehmlich als politische Zurückhaltung in Bezug auf den Nahostkonflikt und der parallelen rhetorischen Überhöhung Israels. Ironisch kommentiert er den bisweilen vorgebrachten Vorwurf, dass Deutschland sich mit seiner Staatsräson von israelischen Interessen abhängig mache: Wie seine Analyse zeigt, habe Deutschland gegenüber Israel stets im besten Eigeninteresse gehandelt. So auch in der aktuellen Phase der Staatsräson.
Erkaufte Identitätspolitik
Marwecki kommt zu dem Ergebnis, dass die deutsche Israelpolitik im Kern erkaufte Identitätspolitik sei. Die „besondere Verantwortung“ gegenüber Juden als allumfassende und doch kaum fassbare Staatsräson mit dem Ziel der moralischen Entlastung Deutschlands gegenüber Israel – all das wurde mit Geld bezahlt. Dem lag das zweckorientierte Interesse zugrunde, sich als Akteurin in der Weltpolitik zu repositionieren.
Bemerkenswert sind dabei insbesondere die von Marwecki platzierten Zitate deutscher Politiker:innen im Laufe der Jahrzehnte. Hier reiht sich purer Antisemitismus, der insbesondere die Rhetorik der Anfangsjahre der Beziehungen auf deutscher Seite immer wieder prägte, an offen rassistische deutsche Überidentifikationen mit dem jüdischen Staat.
Marwecki konstatiert aber auch eine melodramatische Erlösungsrhetorik, wenn deutsche Politiker:innen über Israel sprechen. Er zitiert bspw. einen CDU-Politiker, der anlässlich eines Jahrestags der israelischen Staatsgründung davon spricht, dass Israel die Hölle durchschritten habe, um am Ende einen eigenen Staat zu erhalten. Marwecki schlussfolgert, dass Aussagen wie diese die deutsche Sehnsucht nach Erlösung von der Schuld illustrieren. Auch die wundersame Vergebung Israels für die deutschen Verbrechen werde in Bundestagsdebatten gerne betont. Von der Tatsache, dass diese vermeintliche Vergebung für Israel in den ersten Jahren überlebensnotwendig war, finde sich keine Spur in der Selbstbeweihräucherung deutscher Politiker:innen.
Kein Wort zu Palästina
Eine weitere Erkenntnis, die nach der Lektüre nachhallt: die Palästinenser:innen, ihre Erfahrungen und Geschichte sind in der deutschen Rhetorik wie Politik größtenteils abwesend. In Hinblick auf die deutschen Reparationszahlungen spielten sie keine Rolle; eine Lösung des Konflikts war keine Bedingung für die finanzielle und wirtschaftliche Hilfe. Marwecki zitiert auch Willy Brandt, der 1971 zwar das „Elend der palästinensischen Araber“ anerkennt, aber gleichzeitig deutlich macht, dass die deutsche Verantwortung Israel gelte. Der Autor schließt sein Buch mit dem Verweis auf die aktuelle außenpolitische Blockadehaltung Deutschlands bei den Vereinten Nationen hinsichtlich eines langanhaltenden Waffenstillstands in Gaza mit der bitteren Erkenntnis, dass den Preis für die deutsche Staatsräson aktuell andere zahlen: die palästinensische Zivilbevölkerung. Der Eindruck einer deutschen Außenpolitik im besten Eigeninteresse zieht sich so von den Anfängen der israelisch-deutschen Beziehungen bis in die Gegenwart.
Gegen die Leerstellen
Marweckis Buch füllt nicht nur in der öffentlichen Debatte zum Konflikt zwischen Israel und Palästina eine Leerstelle. Während der Diskurs in Deutschland sich viel um Israel als (positives wie negatives) Symbol dreht, gibt es nach wie vor wenig Interesse daran, sich mit dem tatsächlichen politischen Gemengelage vor Ort auseinanderzusetzen. Diese Lücke existiert auch in der (deutschen) Politikwissenschaft und den Studien zur WANA-Region. Mit der Verknüpfung von historiographischer Recherche und politischer Analyse zeigt Marwecki demgegenüber, wie gewinnbringend empirische Forschung für eine Debatte sein kann, in der es allzu oft nur um schnelle moralische Positionierung geht.
Trotz der immer wieder durchklingenden politischen Haltung verweigert der Autor eine einseitige moralische Positionierung. Ein grundlegend humanistischer Blick auf sowohl Israelis als auch Palästinenser:innen ist in der aktuellen Debatte bereits eine solche Seltenheit, dass man dem Buch dafür die gelegentlichen Redundanzen und den bisweilen etwas flapsigen Ton gerne verzeiht.
„Absolution?“ ist insgesamt ein treffsicherer Zwischenruf in die selbstbezogene deutsche Israeldebatte. Marwecki mutet den Lesenden Komplexität zu und regt zur Auseinandersetzung mit seinen Thesen und weiteren Recherchen zu den deutsch-israelischen Beziehungen an. Die Lektüre lohnt sich für alle, die ein tiefergehendes Verständnis der deutsch-israelischen Beziehungen erlangen wollen und dabei nach Hintergründen und Verständnis statt schneller Polemik suchen.
Daniel Marwecki: Absolution? Israel und die deutsche Staatsräson, Wallstein Verlag, Göttingen 2024, 212 S., 22 €.