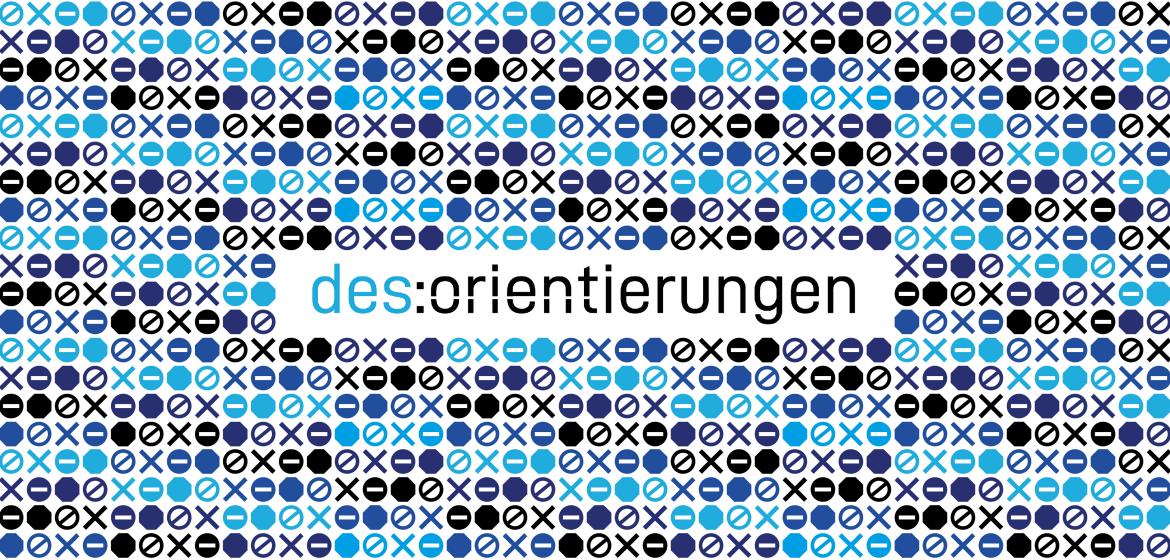Immer mehr Stimmen fordern, die Türkei wegen ihrer aggressiven und diskriminierenden Politik zu boykottieren. Das ist nicht nur wenig zielführend, es schadet sogar jenen Minderheiten, für die man sich vermeintlich einsetzt, meint Cem Bozdoğan.
Es vergeht gefühlt kein Monat, ohne dass die Türkei wegen völkerrechtswidrigen Angriffen oder Kriegsverbrechen in die Schlagzeilen kommt. Im vergangenen Juni noch bombardierten die türkischen Streitkräfte das Geflüchtetenlager Mexmûr und die vom sogenannten „Islamischen Staat“ befreite Stadt Şingal in Südkurdistan, also im Nordirak. Die türkische Regierung gab vor, gegen die als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK vorgehen zu wollen – die Bomben trafen jedoch vor allem die Zivilbevölkerung.
Bereits nach den Luftangriffen nahm die Diskussion rund um einen „Boykott der Türkei“ wieder Fahrt auf. Die derzeitige türkische Beteiligung am armenisch-aserbaidschanischen Konflikt in Bergkarabach brachte das Fass dann wieder einmal zum Überlaufen: So hat etwa die „Boycott Turkey“-Kampagne in Großbritannien erneut dazu aufgerufen, türkische Marken zu boykottieren, um Kriege der Türkei nicht mitzufinanzieren.
Die Initiative möchte vor allem Leute im europäischen Ausland dafür sensibilisieren, nicht mehr mit Turkish Airlines zu fliegen und türkische Marken wie Beko zu meiden. Aber sie richtet sich auch gegen die Produkte von Unternehmen, die direkt oder indirekt in die Türkei investieren, so beispielsweise das Unternehmen Nike, welches die Trikots der türkischen Nationalelf sponsert.
Doch ist ein Boykott der richtige Weg, um politischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben? Ist das die gerechte Lösung für jene, die unter der kriegslüsternen und aggressiven Regierungsführung des türkischen Präsidenten Erdoğan leiden?
Dem Boykott sei Dank
Zweifelsfrei lässt sich sagen: Ein Boykott ist ein legitimes politisches Mittel und hat sich im Laufe der Geschichte zum Symbol des friedlichen Widerstandes entwickelt. Als in Großbritannien Ende des 18. Jahrhunderts Gegner*innen der Sklaverei zu einem Boykott von Zucker und Rum aus den Kolonien aufriefen, führte das zu einem Verbot des transatlantischen Sklavenhandels, dem bis dato zahlenmäßig größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte.
Auch in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung war der Boykott Teil des politischen Widerstandes gegen die rassistische Segregationspolitik. Die Afroamerikanerin Rosa Parks wurde 1955 in Montgomery inhaftiert, weil sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus an eine weiße[1] Person abzugeben. Als Reaktion darauf startete die Schwarze[2] Bevölkerung, unter ihnen auch Martin Luther King, einen Bus-Boykott, der 381 Tage anhielt.
Die Aktion ließ die Buspreise aufgrund der ausbleibenden Einnahmen ansteigen und setzte die Stadt massiv unter Druck. Letztendlich erklärte das Bezirksgericht von Montgomery die Segregation in Bussen für verfassungswidrig. Rosa Parks und die Boykottierenden sind Held*innen, die in ihrer eigenen Community gezielt Ungerechtigkeit ansprechen und ihre Unterdrücker einschüchtern konnten. Doch kann eine „Boycott Turkey“-Kampagne das auch?
Es kommt auf den Kontext an
Nein, denn als Einwohner*innen sicherer EU-Staaten zum Boykott gegen ein Land aufzurufen, ohne dabei die Konsequenzen vor Ort miterleben zu müssen, zeugt mehr von unseren Privilegien, als dass den Menschen in der Türkei und in Kurdistan wirklich hilft. Die türkische Wirtschaft erlebt aktuell höchst turbulente Zeiten, der Wechselkurs ist auf einem Allzeittief. Trotzdem betreibt die Regierung weiter ihre neoliberale Wirtschaftspolitik: Unbeirrt steckt sie spekulatives Kapital in Großbauprojekte ohne nachhaltige Wertschöpfung und blendet dabei ökologische und soziale Faktoren völlig aus.
Expert*innen sagen, dass dieses Modell langfristig nicht gutgehen kann – erst recht nicht in Zeiten einer Pandemie, die für den Tourismus, eine der Hauptsäulen der türkischen Wirtschaft, massive Einbrüche mit sich bringt. Davon betroffen sind nicht nur türkische Unternehmen, sondern auch kurdische, alevitische oder ezîdische Kleinhändler*innen.
Gerade für Menschen, die selbst einen biographischen Bezug zur Türkei oder zu Kurdistan und Familienmitglieder vor Ort haben, kann ein Boykott nicht die gerechte Form des Widerstands sein. Letztlich wären ihre eigenen Familien unmittelbar von einem solchen Boykott betroffen. Kurd*innen und andere Minderheiten leben im System, sie zahlen Steuern an den türkischen Staat, sie sind auf Arbeitsplätze angewiesen. Ein Boykottieren von Gütern, die diese Struktur aufrechterhalten, würde auch ihre Existenz bedrohen.
Gewiss darf die berechtigte Kritik an der Türkei trotz alledem nicht ausbleiben. Wie also ein Land kritisieren, dessen Leute man gleichzeitig verteidigen muss? So wie Rosa Parks und ihre starken Mitstreiter*innen es vorgemacht haben: Ein Boykott funktioniert besser im eigenen System und sollte nicht dazu dienen, die eigenen Privilegien zu reproduzieren. Zu versuchen Erdoğan mit einem Boykott wirtschaftlich unter Druck zu setzen, hat ohnehin nur wenig Aussicht auf Erfolg. Deutlich vielversprechender wäre es, gegen die eigenen Regierungen zu protestieren, die Kriege und Konflikte durch ihre Waffenexporte überhaupt erst ermöglichen. Denn nur so sind wir mit Menschen solidarisch, die unter autoritären Regimen leiden.
[1] weiß ist kursiv geschrieben, um die Konstruktion des Begriffes zu betonen. Gemeint ist damit keine bloße Hautfarbe, sondern die privilegierte Position, die innerhalb eines rassistischen Systems mit der Hautfarbe einhergeht.
[2] Schwarz ist weder Adjektiv noch Hautfarbe, sondern eine politisch gewählte Selbstbezeichnung, in Ablehnung kolonialrassistischer Bezeichnungen, und wird deshalb groß geschrieben.