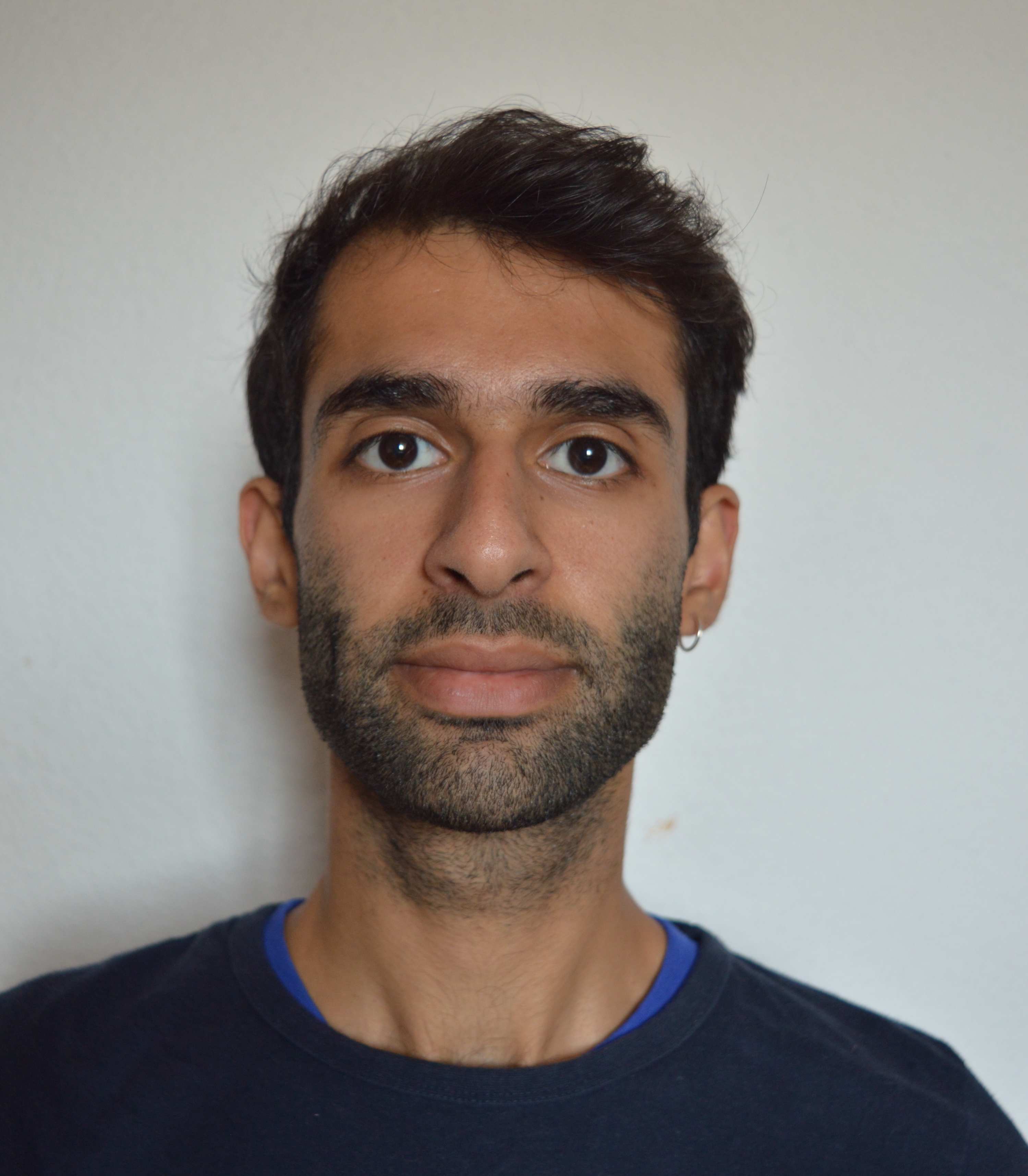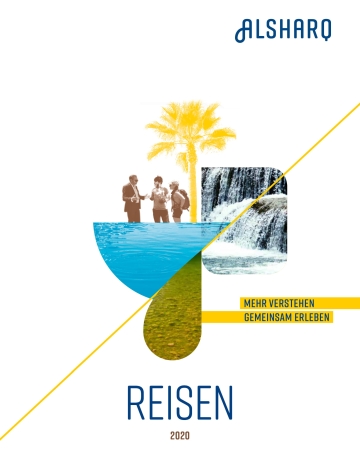Unser Autor fragt sich, wie die Protestcamps an deutschen Universitäten aus Sicht der Teilnehmenden verliefen. Über Stimmen aus Berlin, Leipzig, Freiburg und München und eigene Beobachtungen aus Bremen tastet er sich an ein Lagebild heran.
In mehreren deutschen Städten organisierten Studierende verschiedener Universitäten Protestcamps in oder rund um das Universitätsgebäude. Die Proteste waren eine Reaktion auf die am 6. Mai 2024 begonnene israelische Großoffensive auf Rafah. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten ist für über 1,2 Millionen Vertriebene der letzte Zufluchtsort vor der weitreichenden Zerstörung des Gaza-Streifens. Mit den Aufrufen schlossen sich die Proteste in der Bundesrepublik einer weltweiten Bewegung der letzten Wochen an, die in aller Dringlichkeit ein Ende des Tötens in Gaza fordert.
Die Verantwortlichen in den Universitäten reagierten schnell und repressiv. In den meisten Städten dauerte es nur wenige Stunden, bis sich die Studierenden, ob im Protestcamp oder in unmittelbarer Nähe, zwischen Polizist:innen in voller Einsatzmontur wiederfanden. In nahezu allen Protestcamps folgte eine Auflösung und die Androhung, Strafanzeigen zu erstatten. Viele Protestteilnehmende berichten von Polizeigewalt. Einige Beteiligte wurden bis spät in die Nacht in Polizeigewahrsam gehalten.
Nichtsdestotrotz wurden die Camps auch von Solidarität begleitet: Einige Studierende und Mitarbeitende der Universitäten zeigten Verständnis für die Besetzer:innen und/oder kritisierten die ihnen bekannten Fälle von Polizeipräsenz und -brutalität gegenüber den Protestierenden.
Szenen extremer Polizeigewalt in Berlin
Die Bilder aus Berlin verbreiteten sich in den sozialen Medien am stärksten. Doch die kurzen Videosequenzen sind lediglich Fragmente und ersetzen keine Berichte von Augenzeug:innen. Caro, Studentin und studentische Mitarbeiterin an der Freien Universität (FU), hat selbst am Protestcamp teilgenommen. Wie aus der offiziellen Stellungnahme der FU zu entnehmen ist, war die Universitätsleitung nicht an Verhandlungen interessiert. Laut den Schilderungen von Caro teilte die Universitätsleitung den Studierenden den Räumungserlass mit, noch bevor Studierende ihre Forderungen durch Banner oder Sprechchöre zum Ausdruck bringen konnten. Caro zufolge wurden innerhalb kürzester Zeit alle Eingänge des Hauptgebäudes, in dem das Camp errichtet gewesen war, von der Polizei versperrt. Um ihren Kommiliton:innen zur Seite zu stehen, sollen auch Studierende, die nicht an der Besetzung beteiligt waren, in den umliegenden Straßen ihre Stimme gegen das Vorgehen der Polizei erhoben haben.
Caro schildert die Szenen, die sich innerhalb des Gebäudes abspielten, als Akt brutaler Polizeigewalt: Die Beamt:innen sollen im geschlossenen Raum zu Pfefferspray gegriffen haben, woraufhin die Protestteilnehmenden aus Panik den Feueralarm auslösten und gegen Fensterscheiben schlugen. Caro selbst wurde bei der Räumung von einem Beamten gegen eiserne Fahrradständer geschubst und verletzte sich so stark, dass sie eine Woche bei der Arbeit ausfallen musste und jetzt auf Krücken läuft. Neben Anwesenden wird dieses polizeiliche Vorgehen auch von der internationalen Presse dokumentiert. Ein Video-Beitrag der britischen Tageszeitung „The Guardian“ hält fest, wie gewaltsam die Polizei auf die Protestierenden einwirkt.
Expert:innen wie Prof. Dr. Clemens Arzt, Rechtsprofessor mit Schwerpunkt in Polizei- und Versammlungsrecht, betonen, dass die Auflösung rechtlich fraglich sei: „Versammlungsfreiheit ist das Recht auf Dissens, auf abweichende Meinung. Grenzen setzt das Strafrecht und nicht die Staatsräson der Bundesrepublik Deutschlands.“ Verletzungen wie Prellungen, Verstauchungen und Gehirnerschütterungen sind Folgen des rigorosen Vorgehens. „Das alles im Deckmantel der Sicherheit. Doch Sicherheit für wen?“, fragt sich Caro.
Proteste, die nur wenige Stunden anhielten: Bremen und Leipzig
Auch an der Universität Bremen wurde das Camp auf Anweisung der Universitätsleitung binnen zehn Stunden beseitigt. Rund 16 Polizeiwannen und Polizist:innen versammelten sich in voller Montur um die Glashalle der Universität, ein offenes Gebäude und zentraler Umlaufpunkt, an der auch ich aktuell studiere. Die Auflösung des Camps hielt mehrere Stunden an. Berichten zufolge fanden sich 100 Universitätsangehörige vor der Glashalle zu einer Spontanversammlung. Ich selbst konnte weitaus mehr zählen; fast alle blieben bis zum Schluss.

Der Protest zählte zwischen 20 und 30 Campteilnehmende und wurde seitens der Universitätsleitung zunächst als „friedlich“ markiert. Dass er dennoch aufgelöst wurde, wird von 50 ehemaligen Professor:innen und Absolvent:innen aus Bremen in einem offenen Brief kritisiert. Sie bezeichnen das Vorgehen als einen „Bruch“ in der progressiven Geschichte der einstigen Reformuniversität. Diese habe in der Vergangenheit auch „radikalere Aktionen auf dem Campus ausgehalten und ohne Polizeistaatseinsatz von den Uni-Angehörigen verarbeitet“, so weiter im Schreiben. Als ich bei der Pressestelle der Universität nachhake, behauptet sie zwar, dass es in der jungen Geschichte der Universität bereits im Vorfeld von studentischen Protesten zum Ruf der Polizei kam, nennt mir aber lediglich Beispiele aus den Jahren 1976 und 1995.
Auch wenn ich in Bremen nicht von Studierenden höre, die von körperlichen Verletzungen seitens der Polizei berichten, ist der Fall besonders aufgrund der Geschichte studentischer Selbstorganisierung vor Ort bitter. Die Campteilnehmenden erhielten mehrtägiges Hausverbot und ihnen drohen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch.
Auch in Leipzig wurden Strafanzeigen seitens der Universität ausgesprochen, der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet von mehr als 30. Auf dem Campus Leipzig wurde aufgrund der Offensive in Rafah spontan zu einer Besetzung des Hörsaals sowie zu einer Demonstration aufgerufen. Ungefähr 50 Aktivist:innen besetzten in Leipzig das Audimax. Ines, Studentin an der Universität Leipzig, erzählt mir, dass einige ihrer Freund:innen bis in die Nacht in Gewahrsam gehalten worden sind.
Ines stieß vor Ort offenbar besonders übel auf, wie offenkundig die Polizei gegensätzliches Verhalten an den Tag legte: Ihr zufolge griff sie beim antideutschen Gegenprotest deutlich weniger hart durch als bei den pro-palästinensischen Studierenden. „Es ist eben auch ein Teil von Polizeigewalt, wenn die Polizei sich aktiv dazu entscheidet, bestimmten Studierenden Schutz zu gewährleisten, anderen hingegen nicht.“
Fehlendes Interesse an Dialog?
Dass die Stimmung sich an Universitäten der Bundesrepublik schon lange verändert, nimmt Alfons, ein Student der Universität Freiburg, wahr. In Freiburg hat sich erst kürzlich die Hochschulgruppe „Students For Palestine Freiburg“ gegründet. Wie Alfons berichtet, hat sich die Universitätsleitung erst nach der Errichtung des Protestcamps seit dem 28. Mai 2024 dazu bereit erklärt, mit einzelnen Organisator:innen in einen Dialog zu treten – trotz vorheriger Versuche von aktiven Studierenden. Bisher finden die Treffen nur hinter verschlossenen Türen statt, obwohl Teilnehmende des Protestcamps sich für einen offenen Austausch mit allen interessierten Uniangehörigen aussprechen. „Es scheint, als möchte die Universitätsleitung in Freiburg den Dialog klein halten“, erklärt Alfons.
Aufgrund des fehlenden Austausches mit den Universitätsleitungen fühlen sich Aktivist:innen dazu gedrängt, auf städtischen Boden auszuweichen. Ähnlich ist die Situation bei Studierenden aus München, die im Streit zwischen der Ludwig-Maximilians Universität (LMU) und der Stadt bezüglich des Standorts und der Genehmigung des Camps gerichtlich Recht bekommen haben. Seit nun mehr als drei Wochen veranstalten die Aktivist:innen ein Camp auf dem Geschwister-Scholl-Platz, der in unmittelbarer Nähe zur LMU liegt. Nadine, die Teil des Protestcamps ist, berichtet zwar auch von Schikanen der Universität – die LMU soll den Zugang zur Toilette in unmittelbarer Nähe eingeschränkt haben – erzählt aber von einer grundsätzlich guten Stimmung mit Austausch, der über Veranstaltungen und Workshops angeregt werde.
Von allen Seiten der Ruf nach Polizei?
Während der Fertigstellung dieses Artikels Ende Mai löst die Polizei auf brutale Weise die Besetzung an der Humboldtuniversität zu Berlin (HU) auf. Obwohl die dortige Universitätsleitung die Besetzung vorerst duldete und sogar in einen Dialog mit den Besetzer:innen trat, setzten sich die Polizist:innen durch. Das lag auch daran, dass die Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra und Berlins Bürgermeister Kai Wegner grünes Licht für den Einsatz hunderter Polizist:innen gaben. An der Autonomie, die Universitäten in Deutschland eigentlich genießen, störten die Verantwortlichen sich dabei nicht. Ignacio Rosaslanda, Videojournalist der Berliner Zeitung und offen erkennbar als Presse, wurde von der Polizei verprügelt. Andere Journalist:innen wurden aufgefordert, ihre Pressearbeit zu beenden und das Institut zu räumen.
Egal ob in Großstädten oder kleineren Universitätsstädten: der Ruf der Universitätsleitungen nach Polizei im Hinblick auf die pro-palästinensischen Protestcamps ist zutiefst fragwürdig. Für die meisten Studierenden, besonders für internationale und rassifizierte Personen, begünstigt dies Racial Profiling auf dem Campus durch die Polizei. Für wen dies zu mehr Sicherheit führen soll, hinterfragt auch Prof. Miriam Rürup, Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien. Sie fasst bei der Bundespressekonferenz vom 21. Mai 2024 zusammen: „Was die Geschichte und der Blick in die jüdische Geschichte uns auch noch zeigt, ist, dass der Ruf nach mehr Repression, nach mehr Durchgreifen des Staates, die Aushöhlung von Grundrechten, nicht Jüdinnen und Juden, am Ende des Tages hilft.“