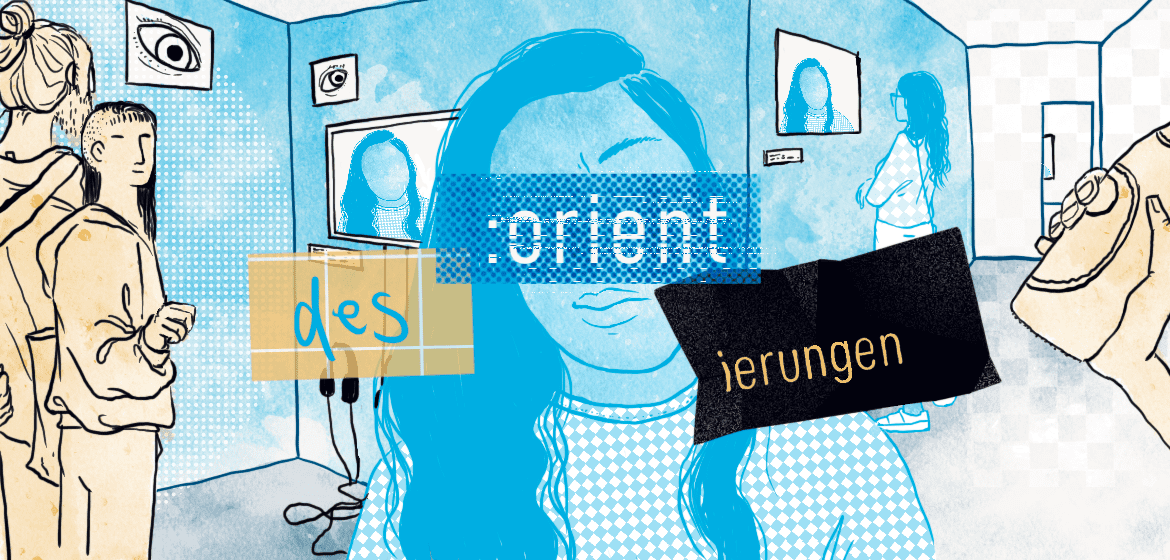Von der Ausstellung zum Ausgestelltsein: Bei einem Besuch der Kunstausstellung „Selbstähnlich“ von Cihan Çakmak und Moshtari Hilal zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen liegt beides nah beieinander, realisiert Mina Jawad.
Eine junge Frau blickt mich an. In der schwarz-weiß Fotographie trägt sie ihre langen, dunklen Haare offen und als Mittelscheitel, ihr Gesicht ist in Nahaufnahme zu sehen. Auf ihr Portrait sind mit schwarzem Stift Haare über ihrer Oberlippe nachgezeichnet worden, ihre Augenbrauen sind durch Striche verbunden und auch ihre Wimpern treten durch die Zeichnung deutlicher hervor. Ich fühle mich ertappt – Das Bild ist eine Entlarvung unserer täglichen Routine des Haarentfernens und Kaschierens. Es spielt mit der patriarchalen Erzählung von Frauen als dem „schönen Geschlecht“. Dabei ist die junge Frau eingerahmt von ebenfalls gezeichneten Blättern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In meiner Fantasie ruft sie mir zu: „Seht her, wir können schön sein, auch ohne unsere Natürlichkeit aufzugeben.“
Wem stehe ich gegenüber? Das Werk trägt den Titel Modar (Farsi für „Mutter“) und ist von der Künstlerin Moshtari Hilal. Es ist in ihrer neuen Ausstellung Selbstähnlich zu sehen, in deren Rahmen sie zusammen mit Cihan Çakmak vom 2. Juni bis 7. August in den Räumen der basis in Frankfurt am Main Fotografien, Zeichnungen sowie Video- und Soundarbeiten präsentiert. Beide Künstlerinnen lassen ihre eigene Existenz mittels ihres Körpers, ihrer Erfahrungen und ihren Familienbiographien in ihr Werk einfließen und stellen damit höchst politische Fragen zu Machtverhältnissen und Ungleichheiten, gesellschaftlichen Normen wie geschlechtlichen Stereotypen, Schönheitsidealen und Zugehörigkeiten.
So gelingt es Hilal mit dem Portrait Assoziationen bei mir zu wecken, wie stark unsere Mütter unsere Vorstellungen von Weiblichkeit prägen und wie diese Schönheitsideale zugleich auch durch eurozentrische Vorstellungen beeinflusst sind. Çakmak inszeniert in ihren Werken Frauen in scheinbar „typisch männlichen“, aber auch „weiblich“ markierten Posen, beispielsweise eine junge Frau, die majestätisch eine Lillie in der Hand hält und dazu ein goldenes Gewand und goldene Ringe trägt. Seitlich auf einem Teppich liegend, auf einem Handgelenk abgestützt und mit angewinkelten Beinen. Das Bild „Frau in Gold mit Lilie“ lässt mich schmunzeln und weist mich zugleich auf die Konstruktion von Männlichkeit und vergeschlechtlichen Machtgefällen hin. Und wie performativ „Geschlecht“ letztendlich ist.
Selbst an der Wand
„Alles wichtige Themen“, denke ich, während ich durch die Ausstellung streife. Und dennoch ist es etwas anderes, das meine Aufmerksamkeit erregt, denn von Kunst verstehe ich eigentlich überhaupt nichts: Ich bin keine Kunstkritikerin, aber Kunst ist höchstpolitisch. Es sind die Ausstellungsräume selbst, die Wechselwirkungen zwischen Werk, Künstlerinnen, Besucher:innen und Institution, die mich beschäftigen. Denn siehe da, während ich die Werke voller Empowerment, Nostalgie und Vertrautheit betrachte, spüre ich plötzlich die Blicke von jemandem, der sich nicht rührt und mich betrachtet, als hinge ich selbst an der Wand. Ob es wohl ein Stück Trauma an mir gibt, das konsumiert werden kann?
Offensichtlich stellen Besuchende, die so aussehen wie ich, eine Abweichung von der Norm dar. Noch klarer wird mir das im Laufe des Abends, als sich bei der Vernissage altbekannte Gesichter beim „who is who“ gegenseitig abchecken und dabei hin und wieder an ihrer Club Mate nippen. Freundliches, gespieltes Lächeln. Smalltalk. All die sozialen Codes und ungeschriebenen Regeln zu Habitus und Duktus der weiß dominierten Kunstszene, die migrantisierten Personen, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit, oft nicht zugänglich ist. Dazu bemerkte ich über die geschlechtlichen Grenzen hinweg eine Häufung von Nasenpiercings, Undercuts und - das im Juni – eine Vielzahl von Hoodies. Und, natürlich, ein bisschen Queer Performance, hier und da. Schließlich ist Pride Month. Die gesamte Diversität des Frankfurter Bahnhofsviertels scheint sich nicht auf das Gebäude der Ausstellungsräume übertragen zu haben. Dazwischen ich, und das ausgerechnet in einem ehemaligen „Gauhaus“ in der „Gutleutstraße“.
Alles andere als selbstermächtigend, stelle ich auf einmal meinen Besuch in Frage. Bilde ich mir das etwa nur ein, unfreiwillig zum Ausstellungsobjekt für andere Besucher:innen geworden zu werden? Betrachte ich die Werke etwa auch so, wie ich in diesem Moment betrachtet werde? Müsste ich die sozialen Codes der Kunstszene nicht auch beherrschen? Voller Scham und Unbehagen ziehe ich mich zurück. Dabei muss ich an die Worte aus einer Videoinstallation von Aidan Jakfar denken, die Monologe afghanischer Geflüchteter gesammelt hat: „Ich kann mich immer noch nicht richtig frei fühlen. Ich denke oft darüber nach, was andere über mich denken. Was die Menschen hier über mich denken.“
Räume einnehmen
An dieser kollektiv performten Norm bei der Ausstellungseröffnung zeigt sich, wer es sich leisten kann, Konstruktionen von Zugehörigkeit, Geschlecht und Schönheit in aller Öffentlichkeit zu diskutieren und immer noch als komplexer Mensch wahrgenommen zu werden und wer dabei einem rassistischen Voyeurismus ausgesetzt ist. Zugleich erinnert mich die Stimme aus der Installation daran, dass es nicht an mir, oder „uns“ liegt, dass wir dadurch unserer Individualität beraubt und einer kollektiven Identität zugeschrieben werden. Es ist unsere (fehlende) Machtposition, die uns dazu zwingt, über Fremd- und Selbstwahrnehmung nachzudenken, während andere einfach gemütlich ihr Getränk schlürfen und einen interessanten Abend haben.
Dennoch nehmen Çakmak und Hilal Raum ein, sie nehmen sich Ressourcen. Es sei ihnen gegönnt! Und auch, wenn sie nicht kontrollieren können, ob ihre Existenzen, ihre Werke bis hin zu Besuchenden dann einem solchen Voyeurismus ausgesetzt sind, so gelingt es ihnen doch, auch diese Ambivalenz in ihrer Kunst einzufangen. Denn auch wenn sie vielleicht nur deshalb Raum einnehmen dürfen, um konsumiert zu werden, so geht es um weitaus mehr als die Entlarvung eines eurozentrischen und patriarchalen Blickes: Zugehörigkeiten und gesellschaftliche Teilhabe. Womit Fragen offenbleiben: Handelt es sich überhaupt um eine gemeinsame Ausstellung oder teilen die beiden Künstlerinnen sich eigentlich nur die Räume? Sind wir Individuen oder die Anderen? Teilen wir uns unfreiwillig eine kollektive Identität, oder machen wir aus der Not eine Tugend, um Kraft und Ressourcen aus dem kollektiven Othering zu schöpfen?
So finde ich in den Werken und den gesamten Räumen mit ihren Dynamiken schlussendlich doch meine eigene Komplexität wieder – im oft auch schmerzvollen Spannungsfeld zwischen Identifikation und Zuschreibung, Individualisierung vs. (scheinbarer) kollektiver Zugehörigkeit. Und so ist der Besuch der Ausstellung Selbstähnlich trotz oder gerade wegen der widersprüchlichen Erfahrungen am Ende des Tages dennoch vor allem eins für mich – selbstermächtigend.
Mehr Arbeiten der Illustratorin Zaide Kutay finden sich auf ihrem Instagram-Account.