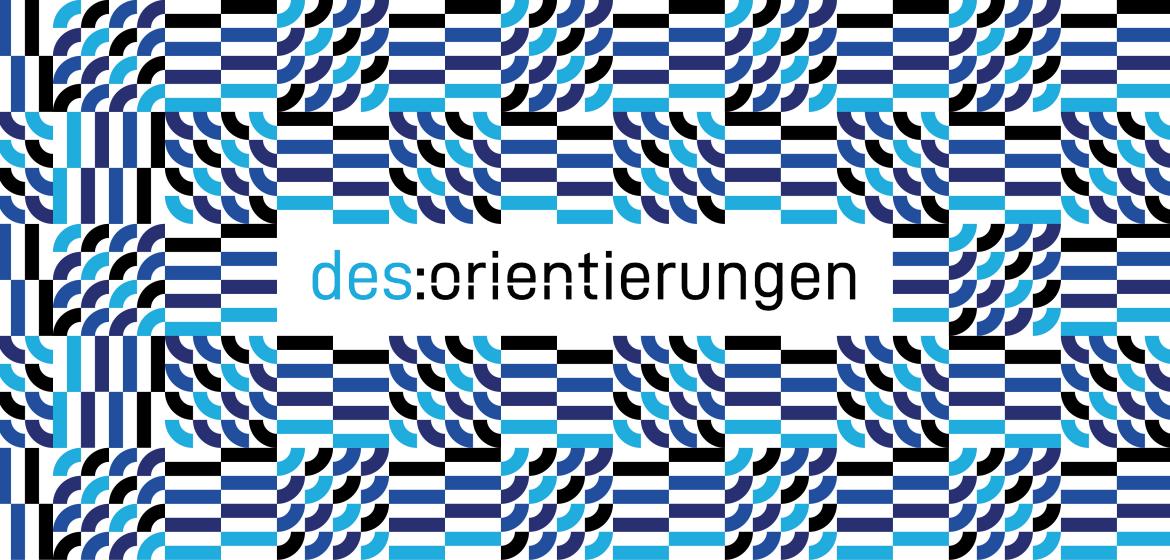Im Al-Khatib-Verfahren verfolgt die deutsche Justiz die Verbrechen des syrischen Regimes. Wenn sie den Prozess nicht ins Arabische übersetzt, droht dieser jedoch einen großen Teil seiner Bedeutung zu verlieren, schreibt Hannah El-Hitami.
Die philosophische Frage mit dem Wald kennt jede*r: Wenn dort ein Baum umfällt und niemand hört es, ist dann ein Geräusch vorhanden? Analog könnte man fragen: Wenn in Deutschland zum ersten Mal die Verbrechen des Assad-Regimes vor ein Gericht gebracht werden und niemand versteht es – ist dann überhaupt Gerechtigkeit möglich?
Seit dem 23. April läuft am Oberlandesgericht in Koblenz der Prozess gegen zwei ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes. Anwar R. und Eyad A. werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen: 58 Tötungen, 4000 Fälle von Folter und zwei Fälle von Vergewaltigung oder schwerem sexuellen Missbrauch.
Die Taten sollen in Syrien begangen worden sein, Angeklagte und Opfer sind Syrer*innen. Trotzdem können Zuschauer*innen und Journalist*innen im Gerichtssaal dem Prozess nur auf Deutsch folgen. Eine Übersetzung ins Arabische gibt es für die interessierte Öffentlichkeit nicht – und das obwohl ohnehin zwei Dolmetscher vor Ort sind, um über Headsets für Angeklagte und geladene Zeug*innen simultan zu übersetzen.
Chancengleichheit für syrische Journalist*innen
Einen Antrag, der den Zugang zur gerichtlichen Simultanübersetzung gefordert hatte, lehnte Richterin Anne Kerber im Juli zunächst ab, mit der eindeutigen, aber unbefriedigenden Begründung: „Die Gerichtssprache ist deutsch.“
Mitte August gab es dann kurz Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Der syrische Journalist Mansour al-Omari hatte gemeinsam mit Hassan Kansou vom Syrian Justice and Accountability Center (SJAC) Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das reagierte mit einer einstweiligen Anordnung, die nun bis zur finalen Entscheidung gültig ist: Akkreditierten Medienvertreter*innen mit besonderem Bezug zum syrischen Geschehen muss ermöglicht werden, das deutsche Verfahren zu verfolgen. Die Chancengleichheit für interessierte Journalist*innen müsse nicht nur theoretisch, sondern realitätsnah gewährleistet werden, hieß es in der Begründung, und dass ein besonderes Informationsbedürfnis unter Syrer*innen bestehe.
Der Teufel steckt jedoch im Detail: akkreditierte*r Medienvertreter*in ist nur, wer sich bis Mitte März bei der Pressestelle des OLG Koblenz gemeldet hat. Nachträglich ist das nicht mehr möglich, obwohl mit dem Zugang zur Übersetzung die Anzahl interessierter arabischsprachiger Journalist*innen gestiegen sein dürfte – mal abgesehen davon, dass auch der Aufruf zur Akkreditierung nur auf Deutsch versendet worden war.
Als Richterin Anne Kerber zu Beginn der Sitzung am 19. August ankündigte, dass nun Übersetzungsgeräte verteilt werden könnten, war die Frustration im Saal entsprechend groß. Zwar hätten mindestens zwei der anwesenden Personen gerne ein solches Gerät entgegengenommen – die Journalistin Luna Watfa und Antragsteller Hassan Kansou selbst, die beide seit Prozessbeginn bei jedem einzelnen Termin dabei waren –, doch aufgrund mangelnder Akkreditierung gingen sie leer aus. Die Geräte wanderten zurück hinter die Richterbank, wo sie niemandem etwas nützen.
Grenzüberschreitende Verbrechen
Das Verfahren um die Al-Khatib-Abteilung des Allgemeinen Geheimdienstes in Damaskus ist von großer historischer Bedeutung. Zum ersten Mal weltweit setzt sich ein Gericht mit der systematischen Folter und dem Verschwindenlassen auseinander, mit dem das syrische Regime seit der Revolution 2011 seine Bevölkerung terrorisiert.
Weil Baschar al-Assad noch immer an der Macht ist, können die Verantwortlichen nicht im Land selbst zur Verantwortung gezogen werden. Ein Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist wiederum nicht möglich, weil Syrien dort kein Mitglied ist und der Weg über den UN-Sicherheitsrat vom russischen Veto blockiert wird.
Mithilfe des Weltrechtsprinzips ist der Prozess also in Deutschland gelandet, wo immerhin mehr als 700.000 syrische Geflüchtete leben. Das Weltrechtsprinzip erlaubt der Bundesanwaltschaft Verbrechen ohne direkten Bezug zu Deutschland zu verfolgen, wenn es sich um Völkerstraftaten wie Genozid, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt.
Schon der Begriff „Weltrechtsprinzip“ macht deutlich: Hier geht es um Themen, die nationalstaatliche Grenzen überschreiten und die internationale Gemeinschaft als Ganze betreffen. Einen solchen Prozess ausschließlich auf Deutsch durchzuführen, ist absurd. Wenn die deutsche Justiz aufgrund internationalen Rechts tätig wird, dann muss sie auch internationale Rahmenbedingungen schaffen.
Dies gilt nicht nur für zukünftige Prozesse gegen das Assad-Regime, die bereits in Vorbereitung sind, sondern auch mit Blick auf vergleichbare Verfahren, bei denen alle Betroffenen aus dem Ausland kommen. So steht zum Beispiel in Frankfurt ebenfalls seit April diesen Jahres das irakische IS-Mitglied Taha Al-J. vor Gericht, seine deutsche Frau parallel dazu in München. In den beiden Prozessen geht es erstmals um den Völkermord an den Ezîd*innen im Nordirak.
Eine Botschaft an die Machthaber in Syrien
Es kann nicht sein, dass Folterüberlebende oder die Familien von Opfern im Zuschauer*innenraum des Saals 128 in Koblenz sitzen und kein Wort verstehen, obwohl das, was deutsche Anwält*innen und Richter*innen dort besprechen sie so persönlich betrifft. Auch für arabischsprachige Journalist*innen macht jede sprachliche Einschränkung es noch schwerer, über einen so langen Prozess zu berichten, was ohnehin zeitaufwändig und teuer ist.
Natürlich können auch deutschsprachige Journalist*innen den Prozess für die Öffentlichkeit sichtbar machen und ihre Berichte in andere Sprachen übersetzen lassen. Zudem sagen viele Zeug*innen auf Arabisch aus, sodass einige der Vernehmungen für das syrische Publikum verständlich sind. Trotzdem ist schwer nachvollziehbar, warum die deutschen Richter*innen nicht alles daransetzen, dieses Verfahren so zugänglich wie nur möglich zu machen. Denn seine Bedeutung liegt vor allem in der Teilhabe der syrischen Bevölkerung und in der Botschaft, die es an die Machthaber in Syrien sendet.
„Der Schuld- oder Freispruch der konkreten Angeklagten ist weit weniger bedeutsam als die Symbolwirkung des Prozesses an sich“, schreiben Boris Burghardt und John Philipp Thurn vom Forum Justizgeschichte e.V. Es gehe vor allem darum, ein Zeichen zu setzen, dass Völkerrechtsverbrechen stets und überall strafbares Unrecht seien. „Auch das Al-Khatib-Verfahren in Koblenz erfüllt seinen eigentlichen Zweck nicht dadurch, dass die Angeklagten abgeurteilt werden, sondern erst dann, wenn der Prozess weltweit als ein exemplarisches Zeichen gegen die Straflosigkeit verstanden werden kann.“
Ähnlich sieht es Mohammad Al Abdallah, der Geschäftsführer von SJAC: „Gerechtigkeit muss nicht nur hergestellt werden“, schreibt er in einem Statement zur Verfassungsbeschwerde, „sondern sie muss sichtbar hergestellt werden.“ Sichtbar, das würde in diesem Fall verständlich bedeuten – und zwar für die Menschen, um deren Gerechtigkeit es hier eigentlich geht.