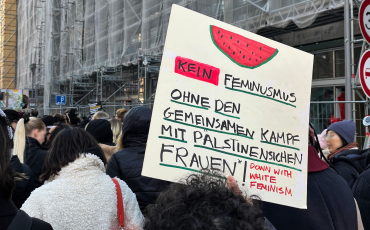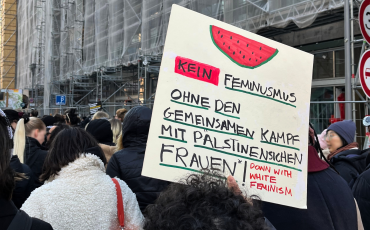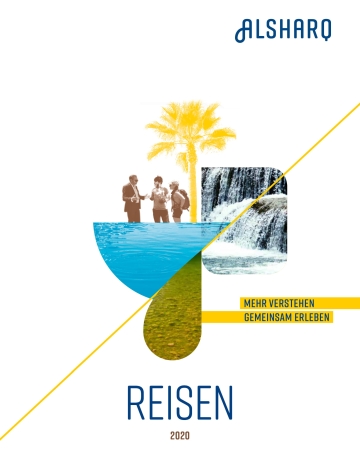Israels Krieg in Gaza erinnert an die düstersten Kapitel des europäischen Kolonialismus. Der Autor liefert eine israelische Perspektive auf die letzte Offensive „Gideon’s Chariots“ und ruft zur Dekolonisierung auf. Eine Analyse des inner-israelischen Dissens.
Nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 startete Israel in Gaza eine Militäroffensive von bislang unbekanntem Ausmaß. Der interne Name: „Gideon’s Chariots“ – ein biblischer Verweis, der an mythologische Übermacht erinnert und die Logik von Kolonisierung widerspiegelt. Doch diese Operation ist mehr als nur ein Name mit Symbolkraft. „Gideon’s Chariots“ steht für einen Krieg, der sich durch massive Luftangriffe, Bodenoffensiven, gezielte Tötungen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Zielauswahl auszeichnet – und dabei vor allem für die Zivilbevölkerung verheerend ist. Die religiös aufgeladene Rhetorik soll dieser Gewalt den Anschein von vermeintlicher historischer Gerechtigkeit verleihen.
Hinter der religiös-politischen Fassade steckt jedoch ein kaltes Machtkalkül: Für Premierminister Benjamin Netanyahu ist der Krieg zur politischen Überlebensstrategie geworden. Innenpolitisch stark unter Druck – nicht zuletzt wegen gescheiterter Geiselabkommen und anhaltender Korruptionsverfahren – setzt er auf einen „totalen Sieg“ in Gaza, um sich als unverzichtbaren Krisenführer zu inszenieren, obwohl die Mehrheit der israelischen Bevölkerung sich einen Waffenstillstand, um die Geiseln zu befreien, wünscht. Doch Netanyahu ignoriert diesen Wunsch. Er befeuert stattdessen den Nationalismus und verweigert sich jeder politischen Lösung. „Gideon’s Chariots“ ist damit nicht nur ein militärischer Feldzug – es ist ein gut getarntes politisches Manöver, das mit dem Leid und Tod tausender Palästinenser:innen bezahlt wird, während die Zahl der Opfer Tag für Tag steigt.
Rufe nach Sanktionen gegen Israel werden laut
Die Logik hinter der Offensive erscheint auf den ersten Blick simpel: Die Hamas soll zur Kapitulation gezwungen, ihre Führung ins Exil vertrieben und alle Geiseln – ob tot oder lebendig – befreit werden. Doch es ist nicht die Hamas, die den Preis zahlt, sondern die palästinensische Zivilgesellschaft. Die gesamte Infrastruktur Gazas liegt in Trümmern: Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Versorgungseinrichtungen wurden zerstört. Es gibt keinen sicheren Ort mehr für Zivilist:innen.
Wie viel sollen die Menschen in Gaza noch aushalten, nachdem bereits über 55.000 von ihnen getötet und Hunderttausende verletzt wurden? Die Zahlen dürften weiter steigen – viele Tote liegen noch immer unter den Trümmern. Das ist nicht nur ein Krieg, es ist eine humanitäre Katastrophe. Und doch schwieg die Welt für lange Zeit.
Während die USA und China zögern, sich gegen das Massaker in Gaza zu positionieren, haben Großbritannien, Frankreich und Kanada Israel inzwischen mit Sanktionen gedroht. Am 29. Mai forderten hunderte Jurist:innen in Großbritannien Sanktionen. Der deutsche Kanzler Merz kritisierte den Krieg zwar am 27. Mai, beschloss jedoch am 4. Juni, weiterhin Waffen an Israel zu liefern – und ignoriert so Deutschlands Verantwortung in diesem Konflikt.
Die Auswirkungen kolonialer Kontinuitäten auf die Palästinafrage
Die Operation „Gideon’s Chariots“ markiert den vorläufigen Höhepunkt eines kolonialen Langzeitprojekts. Wer dies verstehen möchte, muss den Krieg im Kontext des modernen Kolonialismus betrachten.
Israel wurde 1948 gegründet, als die europäische Kolonialherrschaft in Afrika und Asien bereits zu bröckeln begann. Die Ausrufung des Staates Israels bedeutete gleichermaßen den langersehnten Erfolg für die kolonialen Bestrebungen des Zionismus, wie für rund 750.000 Palästinenser:innen die Nakba (dt.: „Katastrophe“): Eine gewaltsame Vertreibung und Enteignung der palästinensischen Bevölkerung, abgesichert durch eine neue Gesetzeslage. Mit der Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens im Jahr 1967 wurde Israel endgültig zur vollumfänglichen kolonialen Macht.
Die Oslo-Verträge von 1993 gaben zeitweise Grund für Hoffnung auf Frieden. Doch seit dem 7. Oktober führt Israel einen Krieg, der in seiner Rhetorik und Brutalität an die dunkelsten Kapitel europäischer Kolonialgeschichte erinnert. Massive Bombardierungen ziviler Gebiete, Hunger als Waffe und die Nutzung von KI-Zielsystemen, die zivile Opfer in Kauf nehmen – Methoden, die führende israelische Militärs selbst als mögliche Kriegsverbrechen einstufen.
Die Parallelen zur europäischen Kolonialgeschichte sind kein Zufall, sondern sich wiederholende Muster gewaltsamer Machtaneignungen: Großbritannien in Indien, Frankreich in Algerien, Belgien im Kongo, Deutschland in Namibia – überall wurde koloniale Herrschaft durch Gewalt, Dehumanisierung und den Mythos einer zivilisierenden Mission aufrechterhalten. Auch heute rechtfertigen israelische Offizielle ihre Gewalt auf ähnliche Weise, indem sie Palästinenser:innen bespielsweise als barbarisch und unzivilisiert darstellen. Netanyahu sprach mehrfach davon, Gaza anzugreifen, um die Zivilisation des Westens zu retten.
Dekolonisierung und ihre Grenzen
Kolonialismus war nie friedlich: Der britische Feldzug gegen den indischen Aufstand von 1857 forderte über 100.000 Tote. Frankreich setzte auf Hunger und Bombardierungen in Algerien und hinterließ nicht mehr als verbrannte Erde. Deutschland beging Völkermord an den Herero und Nama, Belgien verübte Grausamkeiten im Kongo. Und in den USA setzte sich die weiße Vorherrschaft fort, trotz Abschaffung der Sklaverei.
Dekolonisierung war stets ein schmerzhafter, oft blutiger Prozess. Imperien geben ihre Privilegien selten freiwillig auf. Doch sie fallen, wenn die moralischen, wirtschaftlichen und politischen Kosten zu hoch werden – für Beherrschte wie für Herrschende. Israel agiert heute als Kolonialstaat, der sich an seiner Macht festklammert. „Gideon’s Chariots“ zeigt: Wir erleben nicht den Anfang, sondern das nahende Ende der Kolonisierung.
Doch was ist mit der israelischen Gesellschaft?
Noch vor dem 7. Oktober protestierten Hunderttausende gegen die autoritäre Justizreform der Regierung Netanyahus – die größte Protestbewegung in Israels Geschichte. Viele dieser Proteste blendeten zwar die Besatzung in Gaza und im Westjordanland aus, doch sie zeigten einen wachsenden Unmut in der jüdisch-israelischen Gesellschaft. Wird dieser Protest angesichts der Gräuel in Gaza zurückkehren? Oder wird das Trauma des 7. Oktobers und der wachsende Nationalismus die humanistischen Anklagen der Bevölkerung verstummen lassen?
Linke Parteien forderten einen Waffenstillstand, sprachen jedoch kaum über die Dekolonisierung Palästinas. Linke Wertvorstellungen haben nach dem 7. Oktober sicherlich Zugkraft verloren. Nur einige wenige erhoben ihre Stimme, um die Zerstörung der palästinensischen Zivilgesellschaft in Gaza anzuprangern. Einer von ihnen war Yair Golan, Vorsitzender der Demokratischen Partei. Er warf dem israelischen Militär vor, palästinensische Babys als Hobby zu töten, und sprach von einem drohenden Boykott und dem möglichen Paria-Status Israels. Die Reaktion darauf: heftiger, parteiübergreifender Gegenwind. Selbst Oppositionsführer, wie Yair Lapid und Benny Gantz, stellten sich hinter das Militär. Yair Golan zog daraufhin Teile seiner Aussagen zurück – ein weiterer Beleg für das Fehlen einer echten Opposition.
Wie lange kann eine Gesellschaft mit einer permanenten Besatzung, dem moralischen Zerfall und wachsender internationaler Isolation umgehen?
Ein anderer Weg zum Frieden
Es gibt Alternativen – Wege zu einem gerechten und sicheren Frieden, die nicht auf Gewalt fußen. Der Bericht „The Present Moment: Alternatives for a Peace-Seeking Israeli Policy“ (dt.: „Der aktuelle Moment: Alternativen für eine friedenssuchende Israel-Politik”), veröffentlicht im Januar 2025 vom Forum für Ziviles Denken am Van Leer Institut, skizziert diesen Weg:
„Seit Beginn des Krieges verfolgt die israelische Regierung konsequent eine Politik der Beherrschung – begleitet von massiven Kriegsverbrechen. Die Opposition fordert lediglich eine Rückkehr zum Status quo des Konfliktmanagements. Wir hingegen glauben: Nur eine historische Aufarbeitung kann Israel und allen Menschen in der Region ein sicheres, gerechtes Zusammenleben ermöglichen.“
Diese Zukunft – postkolonial, demokratisch und gerecht – ist noch möglich. Aber die Zeit, sie zu erreichen, wird knapp.
Der Artikel wurde vor den Tötungen an in Schlange stehenden Palästinenser:innen nahe der Verteilzentren im Gazastreifen und vor dem israelischen Angriff auf Iran verfasst.